

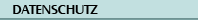 |
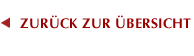
Ein Meseritzer Junge erzählt
von Walter Kintzel, 2014 (Text u. Fotos)
An Laura und für alle meine Enkel und Urenkel!
Am 3. August 2007 unterhielten wir uns beide, liebe Laura, über die Geschichte Deiner Vorfahren. Du sagtest mir damals, dass Du als Schriftstellerin die „KINTZEL-SAGA“ schreiben willst. Ich stelle Dir das Material und die Fakten zusammen, soweit ich sie zur Verfügung habe.
Für Dich bleibt aber noch viel, aber interessante Arbeit.Vielleicht kannst Du noch den Stammbaum der Familie Kintzel vor 1790 ergründen. Wichtig ist für Euch, viele Fragen an Eure Eltern und Großeltern zu stellen, damit das, was sie noch wissen, nicht verloren geht. Eure Enkel und Urenkel werden Euch dafür dereinst sehr dankbar sein!
Da ich die Familienchronik ursprünglich für meine Person erarbeitet hatte, stammt auch das meiste Material aus meinem Lebenslauf. Das war auch maßgeblich für die Gliederung. Die Originale - Urkunden, Fotos, Zeugnisse – sind neben dem Text der einzelnen Kapitel in Aktenordnern (s. Stempeldruck) enthalten.
 Was ein Mensch in seiner Kindheit
Was ein Mensch in seiner Kindheitaus der Luft der Zeit
in sein Blut genommen,
bleibt unausscheidbar.
Stefan Zweig
Wie wahr sind die Erinnerungen eines Schuljungen? Lang lang ist’s her, doch tauchen immer wieder Kindheitserinnerungen auf. Es sind die Erinnerungen, die bleiben, stark davon abhängig, wie stark oder intensiv wir ein Erlebnis oder eine Situation empfunden haben. Kein Mensch kann sich an alles erinnern, was in seiner Kindheit geschehen ist, oft bleiben nur einzelne Vorgänge oder Bilder im Gedächtnis. Dennoch: „Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit“ (Astrid Lindgren).
Es ist sicherlich die kindliche Prägephase, die bei jedem Menschen einen individuellen Erinnerungsschatz entstehen lässt, und er selbst kann oft nicht sagen, warum er sich ausgerechnet an dieses oder jenes Ereignis erinnert. Die Kinder von damals, von denen einige ein ausgeprägtes Erinnerungsvermögen besitzen, sind die letzten Zeitzeugen für die damalige Zeit. „Die Kriegskinder haben jetzt, am Ende ihres Lebens, das große Bedürfnis zu reden“ (WINKELMÜLLER 2011).
Ich gebe hier einige Gedanken der Autorin ANETTE WINKELMÜLLER (Titel: Im Krieg war ich noch klein.) wieder. Es war bis in die 1960er Jahre hinein eine vorherrschende Auffassung, dass vor allem kleine Kinder vieles an Bedrohungen und Leid um sich herum nicht spüren. Inzwischen liegen Untersuchungen vor, die belegen, dass Kinder das Leid ihrer Eltern miterleben und mittragen, oft unbewusst und noch im Erwachsenenalter unbewältigt.
Begleitet von einer Psychotherapeutin, haben Menschen der Geburtsjahrgänge 1930 bis 1947 sich in einer Schreibwerkstatt auf den Weg in ihre kindliche Vergangenheit gemacht. In unterschiedlich langen Texten erzählen sie aus der Zeit, in der sie als Kinder den Zweiten Weltkrieg und die frühe Nachkriegszeit erlebt haben. Ein lebendiges Stück Zeitgeschichte, das ohne nostalgische Verklärung in seiner Unmittelbarkeit berührt, erschüttert und zum Nachdenken anregt.
„Wenn nicht erzählt wird, wie es wirklich war, frei von Ängsten, Vertuschungen und Ressentiments, dann wird die Weitergabe verzerrter Ansichten und Traditionen in den Generationen fixiert.“ (A. WINKELMÜLLER)
Traurigerweise sind viele Zeitzeugen der älteren Generation aus der Sowjetischen Besatzungszone bzw. der ehemaligen DDR, die bei Kriegsende bereits im späteren Erwachsenalter waren, ins Grab gesunken, ohne über ihre Erinnerungen zu sprechen oder gar etwas aufzuschreiben, weil sie daran gehindert wurden.
Über die damit im Zusammenhang stehenden Probleme in Mecklenburg hat MIRJAM SEILS (Titel: Die fremde Hälfte, 2012) ein Buch geschrieben, dem ich einige grundsätzliche Fakten entnommen habe.
Der totalitäre Machtanspruch der Besatzungsmacht und die sich herausbildende SED-Herrschaft prägte den Alltag der Vertriebenen. Über Jahrzehnte war in der DDR eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen nicht möglich, allein schon die Bezeichnung „Flüchtlinge“ war verboten. Die Mecklenburgische Unterabteilung der Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler bei der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern ordnete bereits am 16. 10. 1945 an, „daß die Bezeichnung ’Flüchtlinge‘ in Zukunft fortzufallen hat und dafür die Bezeichnung ’Umsiedler‘ tritt.“ Kulturelle Selbstbewahrung oder Interessenvertretung wurden vom SED-Staat kriminalisiert.
Traditionspflege, Treffen von Schicksalsgenossen und öffentliches Singen von Heimatliedern war verboten. Ein Schreiben der Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler vom März 1948 an die Abt. Rundfunk der Zentralverwaltung für Volksbildung beinhaltete, „dass das Spielen von Liedern, die in irgendwelcher Form an die ehemaligen Ostgebiete erinnern, zu unterlassen sind.“
Das Beziehen oder der Besitz von Heimatbriefen waren strafbar, es führte zu Festnahmen mit Gefängnis- und sogar Zuchthausstrafen. Grundlage dafür war der Artikel 6 der DDR-Verfassung über „Boykott- und Kriegshetze“. Bereits das Wort „Vertreibung“ wurde als hetzerisch bewertet.
Schon durch das Lesen von Heimatblättern gerieten die Vertriebenen in das Blickfeld des Geheimdienstes.
1961 wurde eine Stasi-Direktive erlassen, die festlegte, dass alle Vertriebenen, die bisher an „Revanchistentreffen“ in Westberlin und in Westdeutschland teilnahmen oder in brieflicher Verbindung mit ehemaligen Heimatfreunden oder Landsmannschaften stehen bzw. Empfänger von Heimatbriefen sind, in einer Kerblochdatei zu erfassen sind. Selbst das Erzählen eigener Erlebnisse im privaten Kreis konnte zum Verhängnis werden.Psychologisch gesehen macht die Erinnerung an unsere Vergangenheit einen großen Teil unserer Persönlichkeit aus. Das Abspeichern von guten und schlechten Erlebnissen, positiven und negativen Gefühlen macht uns einzigartig, erklärt Charakterzüge und Empfindlichkeiten. Das Beste, was uns passieren kann, sind angenehme und schöne Kindheitserinnerungen.
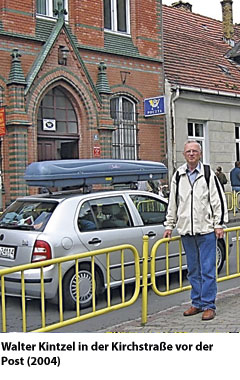 Manche Forscher
vergleichen das Abrufen schöner Kindheitserinnerungen
mit dem Wohlbefinden, das wir beim
Essen von Schokolade oder beim Hören schöner
Musik empfinden. Endorphine werden ausgeschüttet,
die wiederum unser Immunsystem stärken
und unsere Leistungsfähigkeit erhöhen.
Man versucht ja auch immer, einen Zeitpunkt
für ganz frühe Erinnerungen festzulegen, wobei
das ganz schwierig ist. Ich weiß nur noch, dass
ich in der Vorschulzeit Schwierigkeiten hatte, „rot“
und „grün“ (Meseritz hatte damals schon eine Ampel!)
und „billig“ und „teuer“ auseinander zu halten,
was meinen Vater fast „auf die sprichwörtliche
Palme“ brachte.
Manche Forscher
vergleichen das Abrufen schöner Kindheitserinnerungen
mit dem Wohlbefinden, das wir beim
Essen von Schokolade oder beim Hören schöner
Musik empfinden. Endorphine werden ausgeschüttet,
die wiederum unser Immunsystem stärken
und unsere Leistungsfähigkeit erhöhen.
Man versucht ja auch immer, einen Zeitpunkt
für ganz frühe Erinnerungen festzulegen, wobei
das ganz schwierig ist. Ich weiß nur noch, dass
ich in der Vorschulzeit Schwierigkeiten hatte, „rot“
und „grün“ (Meseritz hatte damals schon eine Ampel!)
und „billig“ und „teuer“ auseinander zu halten,
was meinen Vater fast „auf die sprichwörtliche
Palme“ brachte.Ereignisse oder Vorgänge, die stark vom Alltäglichen abweichen, bleiben besonders im Gedächtnis haften. Das gilt für mich bezüglich der Russenzeit in Meseritz vom 30. Januar bis zum 26. Juni 1945 und die anschließende Vertreibung aus Meseritz.
Oft habe ich mir selbst die Frage vorgelegt, ob das alles so stimme, wie ich es beschrieben habe. (In kursiver Schrift habe ich einige Vorgänge oder Fakten gesetzt, die ich nicht selbst erlebt habe bzw. nur gehört habe, und für deren Wahrheit ich nicht bürgen kann). Das trifft besonders auf jene Zeit zu. Auch wenn ich jene Zeit schon separat dargestellt habe (KINTZEL 2012, Museum für Ostbrandenburg in Fürstenwalde) füge ich sie jetzt hinzu, weil sie den Abschluss meiner Kindheit in Meseritz bildet. Außerdem konnte ich sie durch das neuere Studium von Unterlagen im Museum für Ostbrandenburg ergänzen.
Dabei habe ich festgestellt, dass meine persönlichen Erinnerungen auffallend viele Übereinstimmungen mit anderen Erlebnisberichten aufweisen. Ich füge diese Berichte, soweit sie mir zugänglich waren, deshalb meiner Familienchronik – sicherlich auch zum besseren Verständnis für meine Nachkommen, die diese Zeit ja nicht erlebt haben – bei. So werden sicherlich meine subjektiv erlebten Erinnerungen in einen objektiveren Zusammenhang gestellt. Auszüge aus der Chronik der Familie Kintzel will ich nachfolgend darstellen, soweit sie die Zeit betreffen, an die ich selbst Erinnerungen habe bzw. die zum Verständnis der Familiengeschichte beitragen können.
Ich werde meine Darstellungen an den Heimatkreis Meseritz e.V., an die Bibliothek für die historische Region Ostbrandenburg der Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg in Fürstenwalde und an das Museum in Miedzyrzecz, vormals Meseritz, senden. So ist die Garantie gegeben, dass die Nachfahren der Meseritzer über eine bestimmte Zeit in der Stadt ihrer Altvorderen etwas erfahren, und die jetzt dort Lebenden diese Epoche auch als ihre Historie begreifen können.
Mein heimlicher Wunsch ist es, dass über die Russenzeit in meiner Vaterstadt Meseritz und die Vertreibung in deutsch-polnischer Zusammenarbeit eine objektive Geschichtsbetrachtung entsteht, zu der ich mit meinen subjektiven Erinnerungen und den angefügten Berichten der Zeitzeugen einen bescheidenen Beitrag geliefert habe, „denn ohne Geschichte bleibt man ein unerfahrenes Kind“. (LESSING).
Mein Vater
Meine Eltern stammen aus Meseritz. Mein Vater, Paul Gustav Adolf (*1882), war der Sohn eines Zimmermanns. Er ging ab 1895 in die Lehre bei dem Sattlermeister Richter, den wir immer „Onkel Richter“ nannten. Nach der Lehre begab sich mein Vater – wie damals so üblich – auf Wanderschaft. Nach der Militärzeit arbeitete mein Vater in Berlin, hier vor allem als Wagensattler. Gewerkschaftlich war er sehr aktiv, zeitweise als Vorsitzender der Wagensattler von Berlin. Die Jahre in Berlin haben ihn politisch sehr geprägt, denn er war schon 1902 in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands eingetreten. Mit großer Begeisterung erzählte er mir oft von SPD-Veranstaltungen in der Hasenheide, auf denen August Bebel sprach.
Als Demonstrant gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht wurde mein Vater an der Seite des damaligen Reichstagsabgeordneten (1900- 1918) Georg Ledebour von der Polizei verprügelt. (Der Begriff Dreiklassenwahlrecht wird für das Wahlrecht verwendet, das 1849 von König Friedrich Wilhelm IV. in Preußen nach der Revolution von 1848/49 zur Wahl der zweiten Kammer des Landtages, dem Abgeordnetenhaus, eingeführt wurde und bis zum Ende der Monarchie im Jahre 1918 in Kraft blieb. Es handelt sich dabei um eine spezielle Form des Zensuswahlrechts.
Die Bezeichnung rührt daher, dass die Wähler ein nach Steuerleistung in drei Abteilungen („Klassen“) abgestuftes Stimmengewicht besaßen. Unter Zensuswahlrecht versteht man ein Wahlsystem, das ein ungleiches Wahlrecht vorsieht. Wählen darf nur, wer gewisse Finanzmittel nachweisen kann. Der Nachweis erfolgt durch Steueraufkommen, Grundbesitz oder Vermögen. Zwar durften auch die Mindervermögenden wählen, ihre Stimme hatte aber weniger Gewicht.) Diese und andere Willkürma.nahmen verstärkten seine sozialdemokratische Grundhaltung, machten ihn zu einem glühenden Republikaner und Demokraten.
Als Sattlermeister zog er nach Meseritz, wo er sich selbstständig machte. Ich glaube, sein Meisterstück war die Anfertigung eines Kutschgeschirres. Er war Sattlermeister und Tapezierer, zeitweilig sogar Obermeister.
Das Ende des I. Weltkrieges erlebte mein Vater in Meseritz. Hier war er auch Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates. Er muss auch bald (1918?) zum Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins gewählt worden sein, denn das Mitgliedsbuch der SPD meiner Mutter (Nr. 47, 47. Mitglied in Meseritz?) trägt mit dem Datum 1. Januar 1919 die Unterschrift meines Vaters unter der Rubrik „Vorstand“. Aus seinen Erzählungen weiß ich, dass er auch Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Meseritz war (s. Faksimile). Nach den Aussagen meiner Brüder Karl und Hans galt mein Vater in Meseritz als der „rote Kintzel“.
Mein Vater hatte mir in meiner Kindheit, als wir in Mecklenburg wohnten, erzählt, dass er in der Zeit der Weimarer Republik (1919-1933) Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Meseritz war und dort die Funktion des stellvertretenden Stadtverordnetenvorstehers innehatte. Auch soll er SPD-Nachfolgekandidat für den Preußischen Landtag gewesen sein.
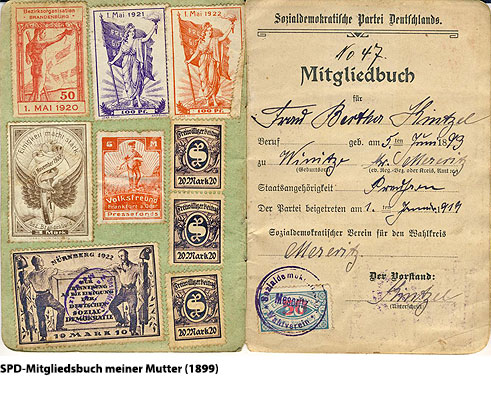
Es entzog sich meiner Kenntnis – er hatte mir nur den Fakt mitgeteilt, keine Zeitspanne, ich hatte auch nicht nachgefragt - in welchen Jahren das war. Auch hatte ich keine schriftliche Nachricht darüber. Vielleicht hatte er irgendwelche schriftlichen Dinge (Zeitungsartikel, Wahlbestätigung, Abgeordnetenausweis, Sitzungsprotokolle o. ä.) aufbewahrt, ob sie die Nazizeit überdauert haben, weiß ich nicht. Nur zu gern hätte ich als Kind irgendwo gelesen „Paul Kintzel ist Stadtverordneter“. Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich schriftlich darüber nie etwas erfahren würde. Dann kam 1990 die Einheit Deutschlands. Mit dem mir innewohnenden Geschichtsbewusstsein, das Heimatliebe zu meiner Geburtsstadt und Familientradition einschließt, hatte ich sofort den Kontakt zum „Heimatkreis Meseritz“ und seinen Veröffentlichungen gesucht. (In DDR-Zeiten war solche Heimatforschung nicht möglich und als „Revanchismus“ verschrien.) Der „Heimatkreis Meseritz“ gibt jährlich vier Hefte heraus, die den Namen „Heimatgruß“ führen. In einem dieser Hefte wurde ich fündig.
Im „Heimatgruß“ Nr. 131 vom Dezember 1994 erschien ein Artikel über die Renovierung des Rathausturmes im Jahre 1924. Im Zuge der Renovierung wurden die vorgefundenen Urkunden und eine „Kunde für spätere Geschlechter“ deponiert. Diese Kunde beschrieb die damalige Situation in der Stadt Meseritz, u. a. wird eine Übersicht zur Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung gegeben. Hier der Auszug:
Die Stadtverordnetenversammlung zählt zur
Zeit 18 Mitglieder und zwar:
Molkereibesitzer Paul Dittmann,
Stadtverordnetenvorsteher
Kreisausschuß-Obersekretär Rudolf Berger,
Maurermeister Paul Donath,
Zimmermann Max Eitner,
Kaufmann Paul Gumpert,
Tischlermeister Robert Griesche,
Rektor Gustav Henschel,
Schneidermeister Reinhold Janisch,
Ackerbürger Johannes Kurtzahn,
Sattlermeister Paul Kintzel,
Eisenbahn-Ingenieur Wilhelm Meyer,
Schuhmachermeister Richard Michalowski,
Oberpostsekretär William Moesicke,
Kaufmann Max Rathe,
Konrektor Robert Schmidt,
Justiz-Oberinspektor Alfred Seiser,
Landwirt Gregor Wilhelm,
Gewerkschaftssekretär Bronislaus Wojciechowski.1994 wurde der Turmkopf erneut restauriert. Man gab das vorgefundene historische Material wieder in eine Kartusche, die in der Turmspitze deponiert wurde. So müsste auch den kommenden Geschlechtern verkündet werden, dass es einmal, als Meseritz noch deutsch war, einen Sattlermeister Paul Kintzel gab, der Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Meseritz war.
Bemerkung: Nach den Erzählungen meiner Eltern war der Abgeordnete Zimmermann Max Eitner SPD-Mitglied; es ist davon auszugehen, dass der Gewerkschaftssekretär Bronislaus Wojciechowski ebenfalls Mitglied der SPD war. Dann waren zusammen mit meinem Vater drei Sozialdemokraten in der Stadtverordnetenversammlung.
Als überzeugter Republikaner und Demokrat war mein Vater in der Weimarer Republik in Meseritz und Umgebung politisch sehr aktiv. Er erzählte mir öfter von Wahlkampfveranstaltungen der SPD in den Dörfern der Umgebung und von Konflikten bei der Beseitigung von SPD-Wahlplakaten durch die Nazis. Listigerweise hatte er sich einen Hund angeschafft, der ihn als Schutz bei seinen Plakattouren begleitete.
Nach den geklebten Mitgliedsmarken im Mitgliedsbuch meiner Mutter zu urteilen sind noch SPD-Beitragsmarken weit in das Jahr 1933 eingeklebt worden, obwohl die SPD als volks- und staatsfeindliche Organisation am 22. Juni 1933 verboten wurde.
In der Werkstatt meines Vaters trafen sich die Mitglieder der verbotenen SPD zu konspirativen Zusammenkünften so bis 1935, denn als sie einmal wieder versammelt waren, machte einer die Bemerkung, dass mein Bruder Hans in der Werkstatt sei und sie sich nicht offen unterhalten könnten. Darauf sagte mein Vater, dass er für seinen Sohn bürge, der würde nichts verraten. Das weiß ich von meinem Bruder Hans, der damals bei meinem Vater in der Lehre war. Irgendwie hat die Polizei aber Kenntnis von diesen geheimen Zusammenkünften bekommen, mein Vater wurde zur Polizei bestellt und mit Haft (Konzentrationslager?) bedroht.
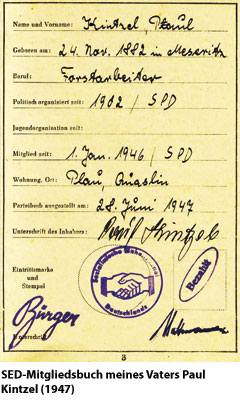 Sein SPD-Mitgliedsbuch rettete mein Vater
über die Nazizeit, in der Russenzeit leistete es
ihm gute Dienste. Als wir im Juni 1945 aus
Meseritz vertrieben wurden, nahm mein Vater die
SPD-Mitgliedsbücher mit. In den Nachkriegsjahren,
als er als Waldarbeiter tätig war, nahm er
sein Mitgliedsbuch einmal in den Wald mit, um es
seinen Kollegen zu zeigen. Im Wald muss er es
verloren und nicht gleich bemerkt haben; danach
war er sehr traurig, hatte er doch damit eine wesentliche
Identifikation seines Lebens verloren. Ich
kann ihn sehr gut verstehen. Ich konnte es nicht
wiedergutmachen, aber dass ich zu seinem Geburtstag
am 24. November 1989 in die SDP (Sozialdemokratische
Partei der DDR) eingetreten
bin, 1990 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Lübz
wurde und schließlich als SPD-Kreistagsabgeordneter
zum Kreispräsidenten im Kreistag
Lübz gewählt wurde, hätte ihn sicherlich mit großem
Stolz erfüllt. So gesehen, habe ich wie kein
anderer seiner Söhne sein Vermächtnis erfüllt.
Sein SPD-Mitgliedsbuch rettete mein Vater
über die Nazizeit, in der Russenzeit leistete es
ihm gute Dienste. Als wir im Juni 1945 aus
Meseritz vertrieben wurden, nahm mein Vater die
SPD-Mitgliedsbücher mit. In den Nachkriegsjahren,
als er als Waldarbeiter tätig war, nahm er
sein Mitgliedsbuch einmal in den Wald mit, um es
seinen Kollegen zu zeigen. Im Wald muss er es
verloren und nicht gleich bemerkt haben; danach
war er sehr traurig, hatte er doch damit eine wesentliche
Identifikation seines Lebens verloren. Ich
kann ihn sehr gut verstehen. Ich konnte es nicht
wiedergutmachen, aber dass ich zu seinem Geburtstag
am 24. November 1989 in die SDP (Sozialdemokratische
Partei der DDR) eingetreten
bin, 1990 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Lübz
wurde und schließlich als SPD-Kreistagsabgeordneter
zum Kreispräsidenten im Kreistag
Lübz gewählt wurde, hätte ihn sicherlich mit großem
Stolz erfüllt. So gesehen, habe ich wie kein
anderer seiner Söhne sein Vermächtnis erfüllt.Ende 1945 begann mein Vater, einen SPD-Ortsverein in der Gemeinde Wahlstorf, wo wir seit dem 1. September 1945 wohnten, ins Leben zu rufen. Es muss besonders unter den Flüchtlingen und Vertriebenen ein großer Zulauf gewesen sein, denn ich fand im Archiv des Landratsamtes Parchim eine Liste mit SED-Mitgliedern aus Wahlstorf, die wie mein Vater dasselbe Eintrittsdatum hatten (s. Faksimile).
Das SED-Mitgliedsbuch ist der Beweis, dass sich ab 1. Januar 1946 die SPD in der Gemeinde Wahlstorf gegründet hatte. Auf den SPD-Mitgliedskarten bzw. Ersatzmitgliedskarte sind wahrscheinlich die Eintrittstermine – bürokratisch verzögert? – eingetragen, bei meinem Vater unter der Rubrik „vor 1933“ auch mit „Apeil 1946“ eine falsche Zuordnung. Diese Mitgliedskarten sind mit einem Aufnahmestempel der SED überstempelt worden. Mein Vater war ein erbitterter Gegner der Zwangsvereinigung von der SPD mit der KPD zur SED. Bereits im Frühjahr 1948 – nach den eingeklebten Mitgliedsmarken recherchiert – ist er aus der SED ausgetreten. Nach seinen eigenen Worten (mir so berichtet):
„Ich mach es wie der König von Sachsen. Macht Euch doch Euren Dreck alleene“. Dann ließ er das berühmte Zitat aus dem Götz von Berlinchen folgen!
Ich bin fest davon überzeugt, irgendwann hätte man ihn aus der SED ausgeschlossen, denn er forderte freie Wahlen und hatte eine Unterschriftensammlung initiiert, die zur Rückkehr der Vertriebenen und Flüchtlinge in die deutschen Ostgebiete aufforderte.
Doch kehren wir in die bewegte Zeit nach dem I. Weltkrieg zurück. Der Kreis Meseritz als Teil der Provinz Posen wurde von polnischer Seite beansprucht. Die Deutschen wehrten sich dagegen und gründeten den „Deutschen Volkstag Westposens“, zu dem Vertreter gewählt wurden.
Mein Vater war im besten Sinne des Wortes ein nationaler Sozialdemokrat. Das zeigt u. a. sein Eintreten für die deutschen Interessen nach dem I. Weltkrieg. So wurde er z. B. zum Abgeordneten des Deutschen Volkstages Westposens am 8. Dezember 1918 gewählt.
Die Waffen sprachen eine andere Sprache, es kam zum Posener Aufstand, er währte vom 27. Dezember 1918 bis zum 16. Februar 1919, es war SED-Mitgliedsbuch meines Vaters ein militärischer Aufstand von Polen in der preußischen Provinz Posen.
Ziel war es, eine Eingliederung der mehrheitlich polnischsprachigen Provinz in den nach dem Ersten Weltkrieg wiedererstandenen polnischen Staat zu erreichen. Die nahe Polnische Armee, die weiter nach Westen drängte, wurde von deutscher Seite als bedrohlich empfunden. Mit einem mehr oder weniger spontan organisierten Grenzschutz (Sammelbezeichnung für die 1918/1919 aufgestellten Verbände aus Freikorps und Freiwilligen-Verbänden) versuchte man zunächst, entlang der neuen Ostgrenze das polnische Vordringen aufzuhalten.
Der Grenzschutz im Kreis Meseritz stand unter der Führung von General Hoffmann, der sich mit seinem Stab im Gebäude der Meseritzer Mittelschule in der Bismarckstraße befand. Im Grenzgebiet lieferten sich Polen und Deutsche bewaffnete Kämpfe. Der deutsche Grenzschutz ging zu Gegenangriffen über und es kam zur Fortsetzung der Kämpfe. Es drohte eine Eskalation und die Gefahr bewaffneter Auseinandersetzungen auch in anderen zwischen Deutschland und Polen umstrittenen Gebieten.
Am 16. Februar 1919 wurde schließlich in Trier eine Verlängerung des Waffenstillstandes der Alliierten mit dem Deutschen Reich unterzeichnet, die auch Bezug auf die Entwicklung in der Provinz Posen nahm.
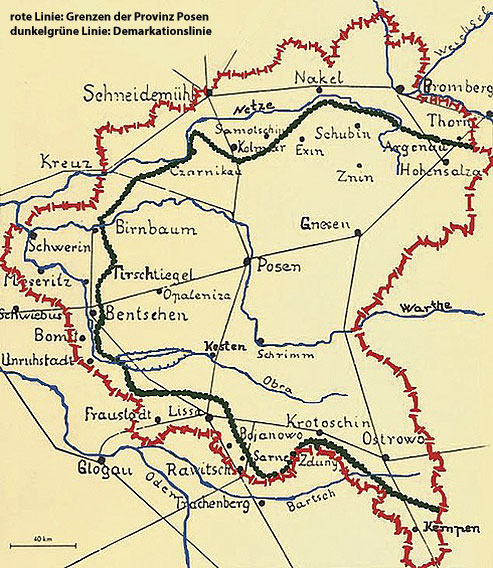
Die Karte zeigt die Grenzen der Provinz Posen und die Demarkationslinie beim Waffenstillstand am 16. Februar 1919. Das Deutsche Reich verpflichtete sich, auf alle Feindseligkeiten an der Grenze zu Polen zu verzichten.
Der Großpolnische Aufstand endete damit offiziell. Die Armee der Aufständischen fand indirekt Anerkennung als alliierte Streitmacht. Faktisch bewirkte der alliierte Druck einen Abbruch der Kämpfe und eine militärische Demarkationslinie wurde festgelegt. Vereinzelt fanden in den Wochen danach noch einige lokale Gefechte statt.
Der Aufstand endete mit einem militärischen und politischen polnischen Sieg. Der Hauptteil der bisherigen Provinz Posen wurde noch vor Inkrafttreten der Bestimmungen des Versailler Vertrages faktisch vom Deutschen Reich abgetrennt.
Am 28. 6. 1919 wurde der Versailler Vertrag zwischen den 26 alliierten und assoziierten Mächten und dem Deutschen Reich zur Beendigung des Ersten Weltkriegs (1914-1918) unterzeichnet, er trat am 10.1.1920 in Kraft.
Im Teil II., Grenzen Deutschlands, hieß es im Artikel 27:
„Die Grenzen Deutschlands werden folgendermaßen festgelegt.
7. Gegen Polen eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die östlich Lupitze und Schwenten verläuft; von dort nach Norden bis zum Nordende des Chlopsees; eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die der Mittellinie der Seen folgt; wobei jedoch Stadt und Bahnhof Bentschen (einschließlich des Knotenpunkts der Linien Schwiebus - Bentschen und Züllichau – Bentschen) auf polnischem Gebiet bleiben; von dort nach Nordosten bis zum Treffpunkt der Grenzen der Kreise Schwerin, Birnbaum und Meseritz; eine im Gelände zu bestimmende Linie, die östlich von Betsche vorbeiführt; von dort nach Norden die Grenze zwischen den Kreisen Schwerin und Birnbaum, dann nach Osten die Nordgrenze Posens bis zum Schnittpunkt dieser Grenze mit der Netze.“
Durch diese Grenzziehung fielen beinahe die ganze Provinz Posen und der größte Teil der Provinz Westpreußen an Polen. Deutschland musste schmerzliche Gebietsverluste hinnehmen. An Polen musste abgetreten werden:
Provinz Westpreußen mit 15.865 qkm und der
Bevölkerung von 965.000 (Jahr 1910)
Provinz Posen mit 26.042 qkm
und der Bevölkerung von 1.946.000 (Jahr 1910)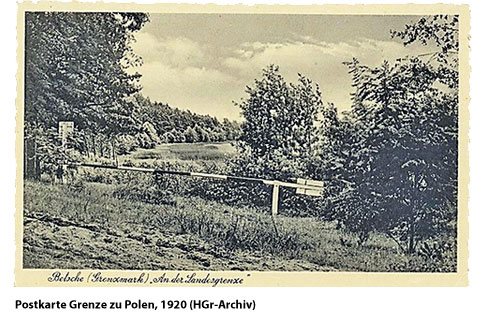
Die schließlich festgelegte Grenze zwischen Polen und dem Deutschen Reich im Posener Land verlief zum Nachteil des Reichs weiter westlich, als es in der Waffenstillstandsvereinbarung zwischen deutschen und polnischen Truppen vom 16. Februar 1919 vorgesehen war. Die damals vereinbarte Demarkationslinie ließ Lissa, Bojanowo, Bentschen und Birnbaum – Orte, die später im Friedensvertrag an Polen fielen – bei Deutschland. Die definitive Grenzziehung zwischen dem Deutschen Reich und Polen entsprach keineswegs den deutschen Vorstellungen.
Lediglich die Kreise mit einer starken deutschen Bevölkerung blieben bei Deutschland: Die Kreise Fraustadt, Bomst, Meseritz (aber der östliche Teil des Kreises Meseritz mit der Stadtgemeinde Bentschen wurde an Polen abgetreten), Schwerin, Schönlanke, Deutsch Krone, Flatow, Schlochau und die Stadt Schneidemühl sowie die östlich von Weichsel und Nogat gelegenen Teile der Provinz Westpreußen wurden nicht abgetreten. Für die bei Deutschland verbliebenen Gebiete der beiden Provinzen musste alsbald eine Verwaltungsregelung getroffen werden. Man sprach zunächst davon, die Kreise an die Provinzen Schlesien, Brandenburg und Pommern anzuschließen, entschloss sich dann jedoch, durch ein preußisches Gesetz vom 1. Juli 1922 einen Auftrag zu erfüllen, der bereits in der preußischen Verfassung von 1919 vorgeschrieben war; die Grenzmark war darin schon als Provinz aufgeführt.
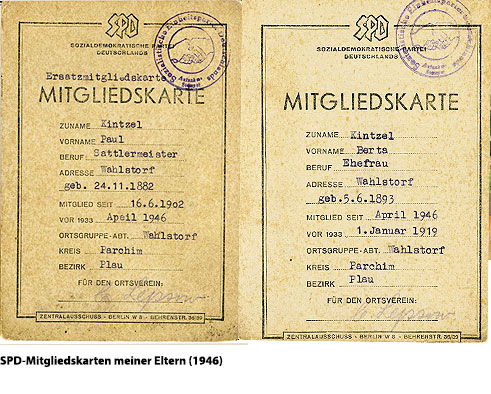
Ab 11. Januar 1921 trug der bisherige Verwaltungsbezirk Grenzmark Westpreußen-Posen die Bezeichnung „Grenzmark Posen-Westpreußen“. Am 1. Juli 1922 kam der Kreis Meseritz zur neuen preußischen Provinz Grenzmark Posen- Westpreußen und ab 1. August 1922 zum neu gebildeten Regierungsbezirk Schneidemühl. So entstand die Provinz Grenzmark Posen- Westpreußen. Der Name hebt ihre Besonderheit hervor. Er erinnert nicht nur an zwei Provinzen, deren Abtretung im ganzen Umfang von deutscher Seite als nicht gerechtfertigt angesehen wurde, wie es auch in der Bezeichnung »Grenzmark« anklang.
Innerhalb der neuen Provinz wirkte mein Vater in der Handwerksinnung und in seinem Beruf als Sattler besonders für die Bauern und Güter der Dörfer um Meseritz, während sich seine Tätigkeit als Tapezierer mehr auf Meseritz beschränkte.
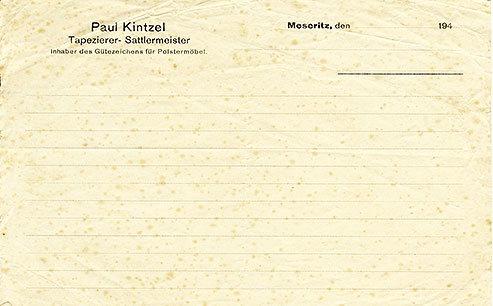
Mein Vater war Sattlermeister und Tapezierer. Das obige Faksimile ist sicher die Vorlage für eine Rechnung. Jedenfalls weist seine Handwerkskarte aus dem Jahr 1931 ihn als Inhaber eines Tapezierereibetriebes aus.
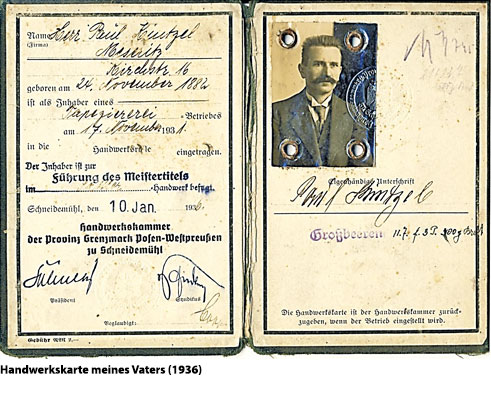
Es ist wie ein Wunder, dass mein Vater so etwas in dem großen Wirrwarr und Durcheinander vor unserer Vertreibung aus Meseritz am 26. Juni 1945 retten konnte und mit auf den Treck nahm.
An dieser Stelle muss ich im Nachhinein meinem Vater hohe Anerkennung zollen, dass er sehr ideell gedacht und gehandelt hat, in dem er wertvolle Familiendokumente, u.a. das Stammbuch, und auch Fotos nicht vergaß. Ich weiß von Freunden, die von ihren Eltern aus der Zeit von vor 1945 keinerlei Fotos mehr besitzen, traurig und tragisch für die Geschichte der einzelnen Familien.
Meine Mutter, Berta Emma Kintzel, geb. Päch, wurde 1893 „auf der Winitze“ geboren. Ihr Vater war Kutscher und Arbeiter, ihre Mutter war Hausfrau. In Meseritz besuchte sie die Volksschule. Die Winitze war eine Landgemeinde und wurde 1923 in die Stadt Meseritz eingemeindet. Ich vermute, dass die Redewendung „auf der Winitze“ daher rührt, dass die Winitze etwas oberhalb der Obra lag.
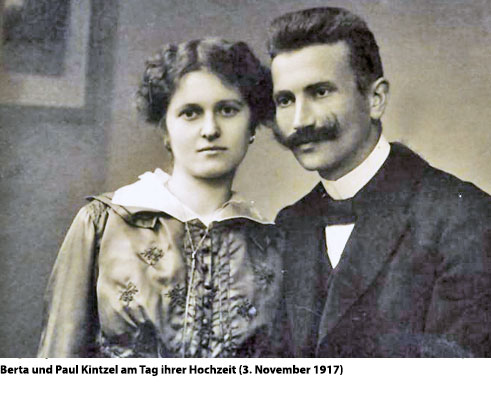
Einige Erlebnisse hat mir meine Mutter aus ihrer Kindheit erzählt. Ich gebe sie wieder, ohne damit ein vollständiges Bild von ihr zu zeichnen, aber vielleicht sind es ja gar die Episoden, die die Persönlichkeit eines Menschen offenbaren.
Als Vorschulkind hatte sie eine Puppe, die sie einmal auf einen Korb mit Kartoffeln gelegt hatte. Beim Ausschütten des Korbes ging die Puppe kaputt, meine Mutti hat sehr geweint. Ihre Mutter sagte zu ihr: „Was heulst Du denn so, Ostern kommst Du ja schon in die Schule.“ (Zu Ostern erfolgte damals die Einschulung der Kinder.) Damit wollte sie ausdrücken, dass meine Mutti doch schon groß sei und nicht mehr mit Puppen spielen müsse. Meine Mutti war damals 5 Jahre alt. Der Hintergrund war aber wohl, dass meine Großeltern so arm waren und keine andere Puppe kaufen konnten. Wenn mir das meine Mutter erzählt hat, als ich klein war, habe ich immer voller Mitleid geweint.
1902 ritt Kaiser Wilhelm II. von Obergörzig kommend über die Winitze zum Bahnhof Meseritz. Die Leute standen alle an der Straße und der Kaiser grü.te vom Pferd militärisch, das mir meine Mutter mehrmals vormachte.
Meine Oma ging oft mit den Kindern in den Wald, um Beeren, Pilze und Reisig zu sammeln. Als einmal ein stattlicher Hirsch ihren Weg kreuzte, legte sich meine Mutter vor Angst schnell unter den Kinderwagen.
Wie es damals so üblich war, gingen die Mädchen aus den armen Familien „in Stellung“, das heißt, sie arbeiteten im Haushalt begüterter Familien. Diesen Weg ging auch meine Mutter, ob sie erst in Meseritz arbeitete, weiß ich nicht, später war sie dann aber in Stellung in Berlin. Dort ging sie auch zum ersten Mal zum Tanz, ihr erster Tanzpartner war ein Trainsoldat (Soldat einer Nachschubeinheit), wie sie es mir erzählte. Im I. Weltkrieg arbeitete sie dann in der Fabrik von Siemens & Halske, wo sie in der Kabelproduktion beschäftigt war.
Ihr Vater, also mein Großvater, war ein Regimentskamerad meines Vaters. Über diesen Weg lernte mein Vater seine zweite Frau, meine Mutter, kennen, seine erste Frau war im I. Weltkrieg an der Schwindsucht gestorben. Aus der ersten Ehe gingen drei Kinder, ein Mädchen und zwei Jungen, hervor, auf die ich später noch eingehen werde.
Meine Mutter und mein Vater hatten drei Söhne: Karl (*1919), Hans-Joachim (*1921) und Walter (*1936), die alle in der Schlafstube in der Kirchstraße 16 geboren wurden. Hausgeburten unter Mithilfe einer Hebamme waren damals üblich.
Meine Geschwister
Aus der ersten Ehe meines Vaters gingen Kurt (*1906), Walli (*1909) und Paul (*1914) hervor. Kurt hatte bei meinem Vater Sattler gelernt, verließ danach Meseritz, heiratete in Niederbayern und kam nach meiner Erinnerung nur sehr selten nach Meseritz. Ich kann mich nur an ein einziges Mal an ihn erinnern, das war im Sommer 1944, als er aus Warschau nach Meseritz auf Urlaub kam.

 Kurz vor Weihnachten 1944 bekamen meine
Eltern die Nachricht, dass mein Bruder Kurt bei
Kämpfen im Raum Warschau als vermisst gemeldet
wurde. Da ich Näheres wissen wollte, erkundigte
ich mich im Jahr 2004 bei der dafür zuständigen
Dienststelle und bekam die Antwor,
dass mein Bruder Kurt in Königsberg gefallen
war.
Kurz vor Weihnachten 1944 bekamen meine
Eltern die Nachricht, dass mein Bruder Kurt bei
Kämpfen im Raum Warschau als vermisst gemeldet
wurde. Da ich Näheres wissen wollte, erkundigte
ich mich im Jahr 2004 bei der dafür zuständigen
Dienststelle und bekam die Antwor,
dass mein Bruder Kurt in Königsberg gefallen
war.Von meinen Eltern mit den drei Söhnen existiert nur ein Foto aus dem Jahr 1941 (Frühjahr?). Es zeigt Karl als Soldat und Hans als Angehörigen des RAD (Reichsarbeitsdienst).
Offensichtlich wurden damals unter dem Druck der russischen Offensive neue Truppenteile zusammengestellt und verlegt, so dass mein Bruder Kurt zu einer Kampftruppe nach Königsberg kam. Das Grenadierregiment 1143 wurde am 6. August 1944 aus Teilen der Grenadier-Regimenter 1141 und 1142 für die 561. Grenadier-Division, später 561. Volks-Grenadier-Division, aufgestellt und wurde bei den Kämpfen in Königsberg vernichtet.
Die Wehrmachtseinheiten, die die Flucht der ostpreußischen Bevölkerung deckten, haben sich richtig geopfert. Dadurch gelang es unter anderem, am 19. Februar den Einschließungsring um Königsberg noch einmal zu sprengen und den Fluchtweg für Zehntausende durch das südliche Samland nach Pillau und dann über See zu ermöglichen.
Mein Bruder Kurt hinterließ eine Frau mit drei Kindern.
Meine Schwester Walli, Jahrgang 1909, heiratete Herbert Loose, einen Friseur aus Niederschlesien, der bei dem Friseur Hirschmann in Meseritz beschäftigt war. Sie zogen nach Berlin, wo sie in Charlottenburg in der Bleibtreustraße ein Friseurgeschäft hatten.

|
Leserbrief von Prof. Markus Krämer, Essen (August 2023) Vielen Dank dem Autor, seine Familiengeschichte mit uns geteilt zu haben. Trotz der Individualität von Familienerinnerungen finde ich biographische Schilderungen im „Heimatgruss“ interessant, da deutsche Geschichte exemplarisch illustriert wird. Walter Kinzel schreibt von seiner Halbschwester Walli, die den niederschlesischen Friseur Herbert Loose geheiratet habe, der beim Friseur Hirschmann in Meseritz beschäftigt gewesen sei. Gleichzeitig zeigt der Autor ein Hochzeitsfoto (s. o.) von Walli und Herbert Loose und fragt sich, warum die Eltern der Braut nicht auf dem Foto abgebildet seien. Dies kann ich zwar nicht auflösen, doch kann ich einen anderen Hochzeitsgast auf dem Foto identifizieren: die fünfte Person von links-stehend hinten ist Erich Pelz, mein Großonkel, der 1905 in Birnbaum geboren wurde, ab 1920 in Meseritz wohnte und der mit dem abgebildeten Bräutigam Herbert Loose befreundet war. Erich Pelz absolvierte von 1920 bis 1923 ebenfalls eine Friseur-Lehre beim Friseur Hirschmann. Im Nachlass des 1994 in Pretoria in Südafrika verstorbenen Erich Pelz findet sich ein Brief des Freundes Herbert Loose, der zeitlich deutlich nach dem 08.07.1943 an meinen Großonkel im rhodesischen Internierungslager geschrieben sein muss. Darin berichtete Herbert Loose davon, dass seine Frau Wally (sic!) jetzt wieder in Meseritz bei den Eltern wohne, dass sein Sohn schon im nächsten Jahr zur Schule komme und er im Heimaturlaub im November in Meseritz seine 14 Tage alte Tochter erstmals kennengelernt habe. Auch auf einen anderen Hochzeitsgast geht er in diesem Brief ein: „Ein Schwager von mir, der damals auch bei der Hochzeit war, befindet sich in englischer Gefangenschaft: von Italien brachte man ihn nach Afrika und jetzt ist er auf dem Weg nach Kanada. Er hat bisher fleißig geschrieben. Er hatte 42 im November geheiratet. Kinder hat er noch keine.“ Insofern zeigt sich, dass individuelle Familiengeschichten vorher verschüttete Querverbindungen zutage fördern und Meseritzer Erinnerungen auch für weitere Generationen lebendig halten. |
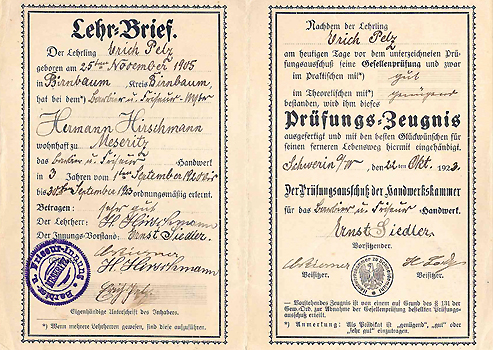 |
| Lehrbrief (Friseurinnung) und Prüfungszeugnis der Handwerkskammer von Erich Pelz (1923) |
Paul Kintzel, Jahrgang 1914, lernte Fleischer bei dem Fleischermeister Leschke in Pieske. Karl Leschke und mein Vater waren zur gleichen Zeit Lehrlinge in Meseritz, der Sattlerlehrling und der Fleischerlehrling wurden Jugendfreunde und sie verband eine lebenslange Freundschaft. In Pieske lernte Paul Kintzel junior auch seine Frau Hildegard Tomiak kennen, die bei dem dortigen Pfarrer in Stellung war. Die Familie Tomiak kam aus dem Ruhrgebiet (Essen) nach Wischen, einem Dorf süd.stlich von Meseritz. Paul und Hildegard heirateten am 3. November 1942 auf der Silberhochzeit von Paul sen. und Berta Kintzel. Zur damaligen Zeit war Paul jun. Soldat, er hatte sich länger verpflichtet und war damals Unteroffizier. Zunächst war er an der Ostfront, wo er schwer verwundet wurde, dann in Italien. Dort geriet er 1943 in angloamerikanische Gefangenschaft und wurde per Schiff in die USA gebracht. Nach dem Krieg wurde er nach England verlegt und wurde von dort (1948?) aus der Gefangenschaft entlassen. Das folgende Foto zeigt meinen Bruder Paul mit seiner Frau Hildegard, es war sein letzter Urlaub in Meseritz.
 |
| Paul und Hildegard Kintzel (Februar 1943) |
Das Foto sammelte mein Vater im Frühjahr 1945 neben anderen Familienfotos aus dem Schutt der gesprengten Postfernsprechzentrale in Meseritz. Den Tipp dazu bekam er von einer Frau aus Meseritz, die unsere Familie kannte und die Fotos dort liegen sah. Plündernde Russen oder Polen hatten neben anderen Utensilien auch die Fotos aus unserer Wohnung in der Kirchstraße (diese stand zu diesem Zeitpunkt leer, s. Russenzeit.) mitgenommen und sie dann weggeworfen.
 |
| Obergefreiter Karl Kintzel als Panzersoldat (1944) |
Karl lernte in Meseritz bei dem Friseurmeister Leo Zwack Friseur. Nach beendeter Lehre ging er nach Berlin. Als Soldat war er u. a. in Nordafrika bei der Rommel-Truppe, in Finnland und an der Ostfront. Nach dem II. Weltkrieg wohnte Karl in Berlin (Ostberlin).
Hans lernte bei meinem Vater Sattler und Tapezierer und sollte das Geschäft meines Vaters einmal übernehmen (s. auch Testament meiner Eltern). Nach beendeter Lehre arbeitete er eine kurze Zeit noch bei meinem Vater, wurde dann zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und danach zur Wehrmacht. Als Angehöriger eines Funktrupps war er an der Ostfront, in der Ukraine, im Kaukasus, in Griechenland und Jugoslawien. Auf dem Rückzug geriet er in Bayern in amerikanische Gefangenschaft und türmte aus dem Gefangenenlager.
Kindheit in Meseritz vor 1945
Da gibt es für jeden von uns die angeblich so wichtigen und bedeutenden Ereignisse, und im Laufe der Zeit vergessen wir die meisten von ihnen völlig, als habe es sie nie gegeben. Und daneben die eine, die andere Kleinigkeit, scheinbar so abseitig und belanglos, und doch bleibt sie uns mit einer schier unglaublichen Anschaulichkeit in Erinnerung und lässt sich heraufrufen.
Herbert Reinoß
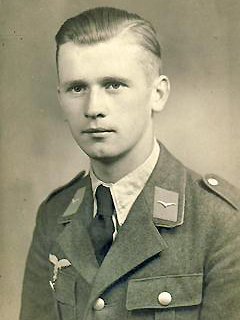 |
| Hans Kintzel als Rekrut (Sommer 1941) |
Als ich 1936 geboren wurde, war meine Mutti todunglücklich. Sie war 43 Jahre alt, mein Vater wurde 54 – und das in einer Kleinstadt zu damaligen Verhältnissen. Als meine Mutti meinem Vater ihre Sorgen „Was soll denn aus dem Jungen mal werden, wir sind bald alt“ kundtat, entgegnete mein Vater: „Du sollst sehen, dessen Kinder schaukle ich noch auf meinen Knien!“
Er sollte Recht behalten, denn 1963 wurde unser ältester Sohn Birger geboren. Sein Enkel Birger war der ganze Stolz des Opas Paul Kintzel, und der Birger war ganz vernarrt in seinen Opa. Mein Vater wollte so lange leben, dass der Birger an ihn noch eine Erinnerung hat, das hat er mir öfter gesagt. Meine Kindheit in Meseritz war eigentlich unbeschwert und glücklich. Meine Mutti war immer zu Hause und daher für mich immer ansprechbar. Als Kind sah ich es immer als großen Vorteil an, dass ich nicht in den Kindergarten – so wie meine Spielgefährten Ingo Ebel und Rüdiger Preuß – „musste“. Ich konnte immer auf dem für uns Kinder großen Hof spielen.
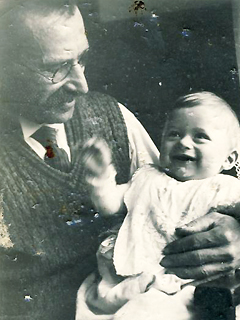 |
| Paul Kintzel mit seinem Sohn Walter (vermutl. Ende 1936/Anfang 1937) |
Das stimmte auch, denn an diesem Tag wurden (eine oder zwei?) Glocken vom Kirchturm abgeseilt, weil aus der Glockenbronze kriegswichtiges Material – Kupfer und Zinn wurden z. B. zur Herstellung von Geschosshülsen verwendet - hergestellt wurde. Welch hoher Wert diesen Metallsammlungen zugemessen wurde, zeigt die Verordnung zum Schutz der Metallsammlung des deutschen Volkes (29. März 1940). Dort heißt es u.a.: „Wer sich an gesammeltem oder von Verfügungsberechtigten zur Sammlung bestimmtem Metall bereichert oder solches Material sonst seiner Verwendung entzieht, schädigt den großdeutschen Freiheitskampf und wird daher mit dem Tode bestraft.“ Für uns Kinder war das Abseilen der Glocken ein spektakuläres Schauspiel.
Der Hof war an der Südseite flankiert von den Holzställen, in denen Holz und Kohlen lagerten sowie Gartengeräte, Fahrräder und auch sperrige Spielsachen, z. B. mein Dreirad. Hinter dem letzten Holzstall, es war unser, befand sich die Aschkuhle, das war also nicht nur eine Deponie für Asche, sondern auch für viele andere Dinge aus dem Haushalt. Manchmal roch es im Sommer ganz durchdringend. Dahinter hatte unser Hauswirt, der Rechtsanwalt Dr. Johannes Ebel, seine Autogarage.
Dann folgte ein Schuppen, wo mein Vater Polstermaterial (Seegras, Rosswolle, Indiafaser) Gestelle, Sprungfedern sowie die Zuppmaschine aufbewahrte. Es schloss sich die Werkstatt meines Vaters an. Ein großer und hoher Bretterzaun grenzte den Hof zur Bischofstraße ab. An der Nordseite befand sich der Spanner, ein Gerüst zum Spannen der Gardinen, das bewerkstelligte meine Mutti. Daran schloss sich ein langer Garten an, von dem der größte Teil uns gehörte. Da zum Nachbarn – Schlosser Ruff – eine hohe Wand stand, auf die die Südsonne brannte, war das ein idealer Standort für Tomaten, zumal die Wand unten schwarz angestrichen war. Das gab herrliche Tomaten. Übrigens: Mein Vater aß zeitlebens immer nur die Tomaten, die er selbst in seinem Garten gezogen hatte. Ein Stück der Wand war mit Weinreben versehen, die dort auch gut gediehen. Das Weinspalier ist in dem unteren Foto mit der Couch gut zu erkennen im HIntergund.
 |
| von links: mein Spielkamerad Rüdiger Preuß, mein Bruder Hans, Lehrling Werner Fesser, Walter (1940) |
Der Hof war unser Spielplatz, im Sommer Fahren mit dem Dreirad, Versteck spielen, Schaukeln in der Hängematte; im Winter bauten wir uns eine Schneeschanze oder legten ein Eishockeyfeld an. Besonders schön, wenn wir bei frostigem Wetter und Mondschein spät am Abend spielen durften. Schlittschuhe hatten wir nicht, wir „schlunderten“ auf unseren Schuhen, der Puck war ein Stück Kohle.
An diese Zeit erinnern auch einige der Fotos. Meine Eltern hatten keinen Fotoapparat, daher sind wohl diese Bilder von meiner Schwester Walli aufgenommen worden, die eine Box, so nannte man damals den billigen Fotoapparat, besaß. Nicht immer sind auf der Rückseite Vermerke, so dass die zeitliche Zuordnung nicht immer einfach ist.
 |
| Kirchstr. 16 (2 Fahrräder stehen im Bild rechts vor dem Haus) |
 |
| Kirchstr. 16 (Blickrichtung Schwiebus – die Uhr von Uhrmacher Handke ist im Bild links zu sehen, ebenfalls die drei Fenster unserer Wohnung.) |
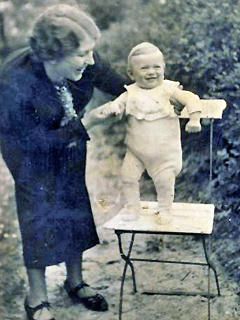 |
| Walter mit Walli (Sommer 1937) |
Von dieser hohen Warte aus in der Kirchstraße 16 diagnostizierte mein Vater immer das Wetter. Es gehörte offenbar zu seinem morgendlichen Ritus, aus dem Fenster nach dem Wetter zu schauen. „Der Wind kommt aus der Dreckecke, es wird bald regnen“, das konnte meinen Bruder Karl immer aufregen; offensichtlich konnte er mit dieser Himmelsrichtung nicht viel oder nichts anfangen. Ich liebte es, über die Dächer der Altstadt zu blicken, besonders im Sommer, wenn die erhitzte Luft über den Dächern flimmerte. Unauslöschlich in mein Gedächtnis eingegraben, sehe ich das heute noch in Gedanken.
Das nächste Foto (aus dem Jahr 1993) habe ich deswegen eingefügt, weil es noch den Anbau zeigt. Der blaue Pfeil zeigt auf ein Fenster, von dem aus man auf das Dach klettern konnte. Aus meiner heutigen Sicht war das kreuzgefährlich, weil ja das flache Dach nirgendwo an der Seite einen Halt bot. Entlohnt wurde man mit einer herrlichen Sicht über die Höfe und Häuser und natürlich mit der kindlichen Abenteuerlust. Allerdings durften das meine Eltern nicht wissen.
Der rote Pfeil zeigt auf eine Kammer, die uns gehörte, und in der meine Schwester Walli untergebracht war, als sie wegen der ständigen Bombenangriffe auf Berlin mit ihrem Sohn Heinz-Jürgen evakuiert war. Im Oktober 1943 kam dann noch ihre Tochter Renate dazu, die in Meseritz geboren wurde.
Die schmale Tür links führte früher in einen Anbau, an dem sich dann die Holzställe anschlossen. Diese Wohnung mit dem Anbau gehörte zu meiner Kindheit dem Friseur Schechner, davor hatten meine Eltern dort gewohnt. Sie mussten diese Wohnung mit dem Laden nach vorn zur Kirchstraße infolge der Weltwirtschaftskrise aufgeben, weil der Verdienst meines Vaters so schlecht war, dass er in die kleinere Wohnung nach oben ziehen musste. Neue Polstermöbel wurden nicht gekauft, die Reparatur alter Möbel wurde von den Leuten solange hinausgezögert, bis es gar nicht mehr ging.
Von dem Fenster, das sich etwa einen guten Meter darüber befand, konnte man auf das Dach des Anbaus gelangen und dann auf dem der Holzställe ein ganzes Stück entlang laufen. Als mein Spielkamerad Ingo Ebel dort wohnte, haben wir Kinder das ein paar Mal versucht.
Im Januar 1945 versuchte die Rose, Dienstmädchen bei Frau Handke, diesen Ausstieg als Fluchtweg vor den Russen zu benutzen.
 |
| Kirchstr. 16, Hofansicht (1993) |
Durch das große Hoftor gelangte man in die Bischofstraße, dort konnten wir auch unbehelligt spielen. Am Ende der Bischofstraße war das Wohnhaus des katholischen Probstes, wir liefen auf das Grundstück und dann schnell am Haus vorbei. Am Ende befand sich eine niedrige Mauer, die wir überkletterten und schon waren wir im Park.
Wir hatten eine Hängematte, die spannte mein Vater an Sommertagen von einem Gartenpfosten bis hinüber zum Holzstall. Es war ein herrliches Gefühl, in der Hängematte bequem zu liegen, mal zu schaukeln und die „Welt“ von oben zu betrachten. Am Muttertag kletterte ich in den Fliederbaum, der am Zaun zur Bischofstraße stand, um dort den Weißen Flieder zu pflücken. Meine Mutter hat sich immer darüber sehr gefreut und erzählte mir später, als ich schon ein Jüngling war, dass ich, als ich noch ganz klein war, immer Blumen gepflückt hatte, aber nur die Blüte, den Stängel ließ ich stehen.
Zu meiner Kindheit zog noch ein Leierkastenmann durch die Straßen und spielte bekannte Weisen. Ich befand mich einmal auf der Kirchstraße vor unserem Haus, vor dem ein Leierkastenmann stand. Mein Vater warf mir Geld aus dem Fenster runter und rief mir zu: „Sag ihm, er soll Lili Marleen spielen.“ Ich gab dem Leierkastenmann das Geld und er erfüllte den Wunsch.
Mein Vater war ein „Kindernarr“ und nahm mich öfter auf Kundschaft mit. „Meester, Sie haben ja gar nicht ihren Jungen mitgebracht“, wurde er von Kunden gefragt, wenn ich im Vorschulalter nicht mit war. Bei der Firma Knorre und Romberg in Landsberg/Warthe kaufte er besonders für das Tapezierergewerbe Materialien ein.
Einige Male nahm er mich dorthin mit, wenn wir mit der Eisenbahn über Schwerin/Warthe nach Landsberg fuhren. Für mich war das immer ein besonderes Erlebnis. Dort sah ich mit der Warthe einen größeren Fluss, von Meseritz kannte ich ja nur die Packlitz und die Obra. Mir schien es, als wolle die Flussbreite der Warthe gar nicht enden. In Landsberg sah ich zum ersten Mal auch Obusse (Trolleybus oder Oberleitungsbus); das waren Busse, die mit elektrischem Strom aus einer Oberleitung (ähnlich wie die „Elektrische“, elektrische Straßenbahn) fuhren.
Einmal nahm mich mein Vater nach Neu Bentschen zum dortigen Bahnhof mit. Der Grenzbahnhof Neu Bentschen musste nach 1918 neu gebaut werden, weil Bentschen mit dem Bahnhof an Polen fielen. Mein Vater war wohl wegen anzufertigender Verdunklungsrollos dort. Wir waren in dem großen Warteraum, in dem auch Soldaten waren und aßen. Vier Soldaten in feldgrauer Uniform saßen an einem Tisch und löffelten ihre Weißkohlsuppe, als plötzlich ein Vorgesetzter (der Spieß?) reinstürzte und laut rief: „Sofort einsteigen, der Zug fährt weiter.“ Die Soldaten mussten ihr Essen stehen lassen und hasteten raus. Offensichtlich war das ein Truppentransport, dessen Weiterfahrt für kurze Zeit unterbrochen war, und die Soldaten nutzten das für die Einnahme einer warmen Mahlzeit.
An einem anderen Tisch saß ein Luftwaffenoffizier, in Zigarettenqualm eingehüllt, störte sich überhaupt nicht an dem brüllenden Spieß und blieb seelenruhig sitzen. Die von mir beobachteten Gegensätze kräuselten sich hinter meiner Stirn zu dem Entschluss, dass ich, wenn ich einmal Soldat werden sollte, so ein Soldat sein wollte, der sich nicht so rumkommandieren lassen musste, und das noch beim Essen. Kindliche Vorstellungen!
Da wir dort über Mittag waren, wollte mein Vater etwas zu essen für uns bekommen. Als er fragte, was wir denn bekommen könnten, wurde ihm von der Köchin „Weißkohl“ gesagt. Mein Vater aß gern Weißkohleintopf, besonders mit viel Kümmel.
Ich aß ihn nicht gern, in jener Zeit war ich überhaupt ein schlechter Esser. Aus Solidarität zu mir sagte mein Vater halb zu mir, halb zur Köchin: „Weißkohl wollen wir nicht essen.“ Das machte mir an diesem Tag meinen Vater sehr sympathisch.
Was das Essen anbelangte, ging es im Haushalt der Familie Kintzel recht frugal zu. Bedingt durch die fast allwöchentliche Angelei meines Vaters gab es viel Fisch, häufig auch Flusskrebse. Der Fisch war gebraten, gekocht oder sauer eingelegt. Sonnabends gab es immer Kartoffelsuppe, mit einer Speckschwarte gekocht. Mein Vater aß gerne Kohlgerichte, also gab es sehr oft z.B. Weißkohleintopf mit Kümmel. Übrigens kannten wir Rosenkohl nicht, den habe ich zum ersten Mal 1945 in Mecklenburg gegessen. Sonntags gab es meistens Bratenfleich mit einer wohlschmeckenden Sauce, das aß ich sehr gern. Meine Mutter konnte sehr gut kochen. Um 15 Uhr (Man sagte in Meseritz „um drei Uhr“.) war wochentags Vesper mit Malzkaffee und Marmeladenstullen. Zu dieser Zeit war auch die „Märkisch Posener Zeitung“ schon ausgeliefert worden, während der Vespermahlzeit las mein Vater in der Zeitung.
Ich ging gern in die Werkstatt zu meinem Vater (er sagte immer „Werkstelle“), um dort das Handwerkzeug meines Vaters zu benutzen. Diese Erinnerungen gehen aber bis in die Vorschulzeit zurück. Besonders gern hämmerte ich, dazu bekam ich von meinem Vater einen kleinen Holzklotz, Nägel und einen Hammer. Ich durfte auch auf das „Ross“, um mit Leder zu nähen.
Das Sattlerross war ein schmaler Sitz, der zwei hölzerne Backen an der Vorderseite hatte, wo man das Leder einspannen konnte. Mit einer Ahle wurde ein Loch in das Leder gestochen, dann mit Pechfaden, der vorher eingewachst wurde, mit zwei Nadeln – mit der einen von links, mit der anderen von rechts – genäht. Ich hatte es bald zu einer Meisterschaft gebracht, denn von klein an wollte ich Sattler werden. Aus Abfällen – eckigen und runden Holzlatten, Verdunklungsstoff, Bindfaden - Nägeln und Schraubösen hatte ich ganz selbstständig ein Verdunklungsrollo angefertigt. Mein Vater war erstaunt, denn man konnte dieses Verdunklungsrollo für ein Minifester nutzen. Es war für mich immer ein besonderes Erlebnis, wenn die Bauern zu meinem Vater Pferdegeschirre brachten oder holten. Sie nahmen mich dann auf ihrer Heimfahrt ein Stück mit, entweder auf dem Wagen oder im Winter auf dem Pferdeschlitten. Ich glaube, in den Dörfern um Meseritz hatte jeder Bauer auch einen Pferdeschlitten. Ich erinnere mich noch an eine Fahrt mit dem Bauern Möhring nach Georgsdorf mit dem Schlitten und an eine Fahrt mit dem Bauern Mücke aus Nipter bis zu Kapplers Wäldchen, weit außerhalb von Meseritz. Den Rückweg legte ich immer zu Fuß zurück.
Der Bauer Mücke ist mir noch in einem anderen Zusammenhang im Gedächtnis geblieben. Im Allgemeinen äußerten sich die Erwachsenen in Gegenwart von Kindern nicht negativ über politische Ereignisse. Die Bevölkerung war aufgerufen worden, Winterbekleidung, insbesondere Pelzbekleidung, für die „Soldaten im Feld“ zu spenden. Bauer Mücke erzählte meinem Vater in der Werkstatt, als er Geschirre zum Reparieren brachte, dass er von einem anderen Bauern (Ortsbauernführer?) aufgefordert worden war, auch seinen Pelz zu spenden.
Mit der sprichwörtlichen Bauernschläue hatte Mücke dem anderen Bauern gesagt, dass diese Pelze bestimmt nur für „Etappenhengste“ Verwendung finden würden. Nach geraumer Zeit teilte der andere Bauer dem Bauern Mücke mit, dass er doch Recht gehabt habe, denn er habe seinen unverwechselbaren Pelz, den er gespendet hatte, bei einem solchen „Etappenhengst“ gesehen.
Aus heutiger Sicht war es von meinem Vater sehr leichtsinnig, den folgenden Witz in seiner Werkstatt zu erzählen, in der ich auch war. Der Witz ging so:
Ein Mann mit einem großen Bart klopfte an die Himmelstür und wollte eingelassen werden, da er Petrus sei. Der richtige Petrus sagte ihm, dass das nicht in Frage komme, da er der Petrus sei. Der Streit wogte hin und her, bis der richtige Petrus zum Herrgott ging und ihn bat, den Streit zu schlichten. Der Herrgott sprach: „Lass den doch bei seiner irrigen Ansicht. Auf Erden gibt es einen, der hat nur solch bisschen Bart unter der Nase und meint schon er sei der Erdengott.“ Nach einer schweren Verwundung kam mein Bruder Paul von der Ostfront auf Genesungsurlaub nach Meseritz. Gelegentlich einer Unterhaltung zwischen meinem Vater und meinem Bruder hörte ich die folgende Aussage von meinem Bruder: „Nach dem Krieg gibt es eine Auseinandersetzung mit der SS.“
Da mein Bruder vorher über Fronterlebnisse berichtete, muss es wohl um Gräueltaten der SS gegangen sein. Offensichtlich war auch ein siegreicher Krieg gemeint. Der Satz ist mit im Gedächtnis haften geblieben, leider habe ich später (nach 1945) weder meinen Bruder noch meinen Vater danach befragt. Wäre diese Aussage damals verraten worden, wäre es sicher das Todesurteil für meinen Bruder wegen Wehrkraftzersetzung gewesen.
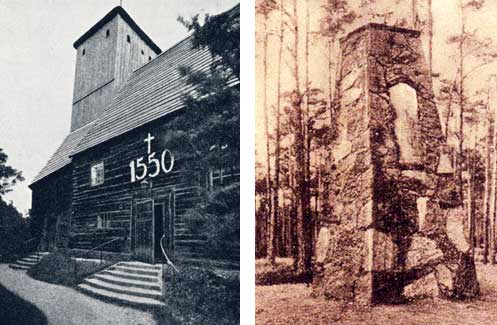 |
| Bild links: Die Holzkirche in Bauchwitz. Bild rechts: Bauchwitzer Wolfsjagd (18. Juli 1852) |
Die Frau meines Bruders Paul wohnte in Wischen. Um dorthin zu gelangen, musste man mit der Eisenbahn bis Bauchwitz fahren und dann einige Kilometer zu Fuß gehen. Was mich in Bauchwitz so beeindruckte, war die Holzkirche mit der Aufschrift „1550“, diese Inschrift war für mich geatmete Geschichte, weil dieses Datum so weit zurück lag.
Heute weiß ich über diese Kirche, die inzwischen abgebrannt ist, dass sie die älteste erhaltene Holzkirche in der ehemaligen Provinz Posen war. Das Dorf Bauchwitz wurde mit seiner Gutswirtschaft zu der Reformationszeit evangelisch und damit auch die Kirche. Somit war die Bauchwitzer Kirche auch die älteste evangelische Kirche im Kreis Meseritz. Ihr erster evangelischer Pfarrer, David Saur, bezeugt für das Jahr 1579, war ein Schüler Philipp Melanchthons, des Freundes von Martin Luther.
Mitten im Wald von Bauchwitz befand sich ein Gedenkstein für den letzten geschossenen Wolf, mein Vater hatte mir den Gedenkstein einmal gezeigt. Mir war als Kind ganz schaurig zumute, als ich dort stand!
 |
| Windmühle bei Wischen |
Hier endete der Kommunist,
der anderer Leute Lämmer frißt.
Für immer stillte dem sein Hunger
Lützower Jäger Joh. Unger
Die Lehre ziehet nun daraus
Jeder verteidigt sein Haus.
In fremd Eigentum einzudringen
Niemals wird Euch das gelingen.
Wolfes Schicksal könnt Ihr Erben,
so wie alle Räuber sterben.
Wahrscheinlich hatte ich schon als Kind eine „romantische Ader“, denn die Windmühle am Dorfrand von Wischen im zeitigen Frühling (1943 oder 1944), als die Weidenkätzchen sich entfaltet hatten, ist mir bis heute als liebliches Bild im Gedächtnis geblieben.
Kahnfahrten auf der Obra waren für mich immer ein besonderes Erlebnis. Etwas unterhalb meiner Großeltern auf der Winitze, also zur Obra hin, wohnte eine Familie Michler. Herr Michler, ein Schulkamerad meines Vaters, hatte einen Kahn, den sich mein Vater mal ausborgte, um mit mir auf der Obra damit zu fahren. Mein Vater hatte eine lange Stakstange, mit der er den Kahn bewegte. An der Obrabrücke gab es einen Kahnverleih. Einmal fuhren meine Tante Selma, sie war die Frau meines Onkels Otto mütterlicherseits, meine Cousine Trautchen und ich mit dem Ruderboot „Froschkönig“ auf der Obra flussaufwärts Richtung Eisenbahnbrücke und dann wieder zurück.
Beim Aussteigen fiel meine etwas vollschlanke Tante ins Wasser, ich lief schnurstracks nach Hause. Das Foto zeigt die Obrapartie, die wir mit dem Ruderboot befuhren. Ich kann mich noch gut erinnern, dass die Soldaten aus dem Reservelazarett in der Volksschule viel mit diesen Ruderbooten fuhren.
 |
| Ruderpartie auf der Obra |
Eines der frühesten Kindheitserlebnisse war ein Feuerwerk, bei dem ich, als der Himmel purpurn und rot gefärbt war, Angst hatte. Wir standen in der Johannesstraße, Ecke Maybachstraße. Da ich annehme, dass nach Kriegsbeginn solche Feuerwerke nicht mehr stattfanden, muss das also schon vor September 1939 gewesen sein.
Ebels Garten war ein Eldorado für uns Kinder. Er war riesengroß und reichte vom Topfmarkt bis an die Packlitz. An der Packlitz befand sich eine kleine Schöpfbank, deren Bretter aber schon etwas morsch waren. Infolge der Bäume, die am Südufer der Packlitz standen war es hier auch dunkel und schattig, so dass wir diese Schöpfbank als Einstieg in die Packlitz nur selten benutzten. In der Nähe befand sich auch eine alte Holzlaube, die ebenfalls im Schatten stand und von uns nur ganz wenig aufgesucht wurde. In der Mitte des Gartens befand sich eine große Rasenfläche mit einer Wippe und einem Sandkasten.
Zentrum für unser Spielen war die Rasenfläche. Hier lagen wir im Sommer im Grase und schauten zu den Wolken auf, schlossen die Augen, öffneten sie nach einer Weile und beobachteten die Veränderungen an den Wolken. Unbeschwerte Kinderzeit! Der Zaun zum Grundstück der Färberei Klein war etwas kaputt, so dass wir da durchschlüpfen konnten und zur Schöpfbank vom Färber Klein gelangten. Die Schöpfbank war relativ groß, lag in der Sonne und vor ihr war sandiger Untergrund in der Packlitz. Von hieraus badeten wir viel.
Durchquerten wir die Packlitz, kamen wir auf ein Gelände, an dem auch noch ein kleiner Graben war. Hier hatten sich ältere Jungen ein hügeliges Gelände geschaffen, das sie „Verdun“ nannten. Es war ihr Bunkergebiet, in dem sie Krieg spielten. Gelegentlich waren wir jüngeren Kinder auch dort, aber nur, wenn die älteren nicht da waren.
Ansonsten haben wir in der Obra an der Pferdeschwemme gebadet, einmal sogar mit Soldatenpferden und Soldaten. Hier war eine große Ausbuchtung der Obra, das Ufer war relativ flach. Über die Bischofstraße, Schulstraße und den Bismarck- Platz waren wir schnell an der Pferdeschwemme. Ich nahm mir immer eine trockene Hose und ein Handtuch mit – kam aber immer mit der angezogenen nassen Badehose, trockene Hose und Handtuch in der Hand nach Hause zurück; ich mochte mich da nicht umziehen! Ich weiß aber auch noch, dass ich im Sommer fast immer einen mächtigen Sonnenbrand hatte, der ganz schön wehtat. In der städtischen Badeanstalt, die hinter der Eisenbahnbrücke lag, war ich nur wenige Male zum Baden.
Mein Vater war in der Freiwilligen Feuerwehr Meseritz und hier Obersteiger. Er war absolut schwindelfrei, mit einer Portion Wagemut ausgezeichnet, das beides hat ihn sicher dafür prädestiniert. Wenn die Sirene ging, kam er aus seiner Werkstatt gestürzt, schmiss sich in seine Feuerwehruniform, hing sich alle Utensilien um und lief zum Feuerwehrdepot. Manchmal auf der Straße, damit es schneller ging, musste er doch dabei keine Rücksicht auf die Passanten auf dem Bürgersteig – „Trittoar“ sagte er immer – nehmen. Einmal erlebte ich, da war mein Vater schon über 60 Jahre alt, wie er bei Feueralarm die Obrastrasse runter lief, es muss wohl ein Sonntag gewesen sein, denn es waren viele Soldaten in Ausgangsuniform unterwegs. Einige amüsierten sich über den laufenden Feuerwehrmann und lachten lauthals. Als ich das meinem Vater nachher erzählte, sagte er zu mir: „Wenn bei denen der Hosenboden brennt, werden sie auch nicht mehr lachen.“
Meistens fuhr er aber mit dem Fahrrad. Meine Mutter erzählte mir, dass meine beiden Brüder Karl und Hans als Kinder so instruiert waren, dass sie, wenn die Feuersirene zu hören war, dem Vater behilflich waren. Der eine holte schnell das Fahrrad aus dem Schuppen und der andere hatte schon die Feuerwehruniform in der Hand. Ganz deutlich habe ich noch einen Einsatz im Gedächtnis, da bin ich nämlich mit meiner Mutter hingegangen. Aus einem Fabrikschornstein in der Schwiebuser Straße, hinter der Packlitzbrücke, hatte ein Storch sein Nest gebaut und damit den Schornstein so verstopft, dass der Rauch nicht mehr abziehen konnte. Also musste die Feuerwehr ran und sollte das Nest runterspritzen. Als ich dann zu dem Feuerwehrmann ganz hoch oben auf der Leiter hinschaute, sah ich, dass es mein Vater war. Er wurde vom runterfallenden Spritzwasser pudelnass, der Storch kehrte aber nach kurzer Zeit zurück.
Ein Feuer erlebte ich, als in Georgsdorf eine Scheune brannte. Woher wir Jungen das wussten, kann ich heute nicht mehr sagen. Jedenfalls liefen wir ein paar Kilometer bis Georgsdorf, um die brennende Scheune und die bei der Brandbekämpfung eingesetzte Feuerwehr zu sehen. Die brennende Scheune, die dann unter dem Feuer in sich zusammen fiel, war für uns Kinder ein Erlebnis. Zu irgendeinem bestimmten Anlass wurden in Meseritz Fotos ausgestellt, u. a. auch welche von der Feuerwehr. Ich kaufte mir das Foto Nr. 16, weil auf dem mein Vater in Feuerwehruniform in der ersten Reihe stand, worauf ich ganz stolz war. Leider ist das auch in der Schulmappe gewesen, die mir von den Polen bei der Vertreibung aus Meseritz weggenommen wurde.
Die große Leidenschaft meines Vaters war das Angeln, fast jedes Wochenende fuhr er mit dem Fahrrad zum Angeln, meist an die Obra nach Obergörzig. Im Sommer fuhr er am Sonnabendnachmittag los, übernachtete im Zelt, das er sich selbst aus Markisenstoff genäht hatte, und kam am Sonntag zum Mittagessen zurück. Öfter durfte ich auch mit. Ich hatte auch eine kleine Angel, aber das Schönste war das Schlafen im Zelt.
Oder wenn ein Gewitter rüber zog, war es im Zelt schön, wenn der Regen auf das Zelt prasselte. Dieses Zelt habe ich während meiner Oberschulzeit und auch in meiner Studentenzeit noch benutzt, als ich mit Klassenkameraden Fahrradtouren durch Mecklenburg unternahm. Später habe ich es auch bei Faltboottouren mit unserem ältesten Sohn, als der Grundschüler war, mitgeführt und darin übernachtet. Beide Jungen hatten es später auch noch benutzt, als sie selbständig Faltboottouren unternahmen. Das Zelt war älter als ich und diente drei Generationen – Friedensware!
Einmal hatten mein Vater und sein Angelkumpan Albert Podraczik, dessen Namen ich immer so schlecht aussprechen konnte, an meine Angel einen Nuckel gebunden und amüsierten sich dann köstlich über meine Reaktion.
Albert, wie mein Vater ihn nannte, kam auch zum Skatspiel zu uns nach Hause, wenn Festtage waren oder mein Vater und mein Opa, Johann Päch, Geburtstag hatten. Am Albert fand ich immer lustig, wenn er „Heil Hitler“ sagte. Er zog das immer so zusammen, dass dabei „Hei Litler“ herauskam. Der Angelkumpan meines Vaters soll beim Einmarsch der Russen im Januar 1945 erschossen worden sein, das betrübte meinen Vater sehr.
Mein Vater angelte hauptsächlich in der Obra. Die Obra muss damals sehr fischreich gewesen sein, denn mein Vater kam immer mit vielen Fischen nach Hause. So lernte ich viele Arten kennen. Ich erinnere mich besonders an Aale, Hechte, Quappen und Welse. Mit etwas Schauern hörte ich die Erzählung, dass in der Obra an der Schlossbrücke ein solch großer Wels war, der sogar das schwimmende Federvieh fraß. Auch dadurch, dass ich mit meinem Vater zum Angeln fuhr und mich dann Tag und Nacht in der Natur aufhielt, hat sich bei mir eine starke emotionale Beziehung zur Natur entwickelt.
 |
| Walter (Pfingsten 1939) |
Nach Obergörzig haben auch Familienausflüge stattgefunden. Davon zeugt das Foto von Pfingsten 1939.
Zu Pfingsten brachte mein Vater von seiner Angeltour immer grüne Birkenzweige und Kalmus mit, die für einige Tage zum Ausschmücken der Wohnung dienten. Besonders den aromatischen Duft des Kalmus habe ich noch „in der Nase“.
Meine Eltern gingen auch öfter mit mir spazieren, z. B. nach Georgsdorf und dann über den „Löwen“ zurück nach Meseritz.
In Georgsdorf gab es eine ganz schmale Fußgängerbrücke über die Obra, zu der es ziemlich steil bergab ging. Einmal wäre ich dort bald in die Obra gefallen. In Richtung Kapplers Wäldchen gab es eine Eisenbahnbrücke im Wald, die unter der Eisenbahnstrecke durchführte und deren Seiten mit Ziegelsteinen ausgemauert waren. Hier verewigten wir uns im Oktober 1943, als wir dort Pilze suchten. Beim Lesen der anderen Inschriften stellten wir fest, dass sich hier meine Brüder schon vor Jahren – neben anderen Namen – „verewigt“ hatten. Offensichtlich wusste mein Vater davon, denn ich war ganz erstaunt, als er aus seiner Westentasche einen Bleistift zog und mich aufforderte, hier meinen Namen mit dem Datum des damaligen Tages zu hinterlassen.
An manchen Sommerabenden sind meine Eltern mit mir mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ich hatte auf dem Fahrrad meines Vaters einen Kindersattel, hielt mich am Lenker fest und konnte in Fahrtrichtung alles beobachten. Mein Vater, ein mit guten Heimatkundekenntnissen ausgestatteter Meseritzer, zeigte mir viel und konnte mir auch viel erklären. Wären wir in Meseritz geblieben, hätte ich sicher davon viel profitiert. Einmal sagte meine Mutter auf einer solchen Tour zu meinem Vater: „Paul, mein Sattel ist zu hoch“, bremste ganz kurz ab, mein Vater fuhr auf das Fahrrad meiner Mutter auf und wir beide stürzten. Ich kugelte den Abhang hinab und landete im Chausseegraben. Als ich mich aufrappelte, sah ich dort ein mir unbekanntes kleines Tier, seit dieser Zeit weiß ich, dass es eine Kröte (Erdkröte) war. So lernt man eben auch etwas!
Es war in Meseritz üblich, zu Fastnacht mit einem Spieß zu Bekannten zu gehen, ein Sprüchlein aufzusagen und dafür Leckereien auf den Spieß gesteckt zu bekommen. Ich zitiere aus meinem Gedächtnis:
Hopsa, in die Fastnacht.
Ich bin ein kleiner König,
gebt mir nicht zu wenig,
lasst mich nicht zu lange stehn,
ich muss ein Häuschen weitergehn….
Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war, aber ich war mit meinem Spieß zuerst zu Bäcker Wagner gegangen, dort bekam ich Schnecken und Amerikaner auf meinen Spieß gesteckt. Anschließend trabte ich dann auf die Winitze zu meiner Tante Frieda, von der ich auch etwas bekam. Es war wohl so, dass sich die Leute schon vorher mit Leckereien eingedeckt hatten, weil sie wussten, dass an der Fastnacht die Kinder mit ihren Spießen kommen.
Mein Vater war schon in der Kaiserzeit aus der evangelischen Kirche ausgetreten, meine Mutter gehörte der evangelischen Kirche an. Meine Erziehung, besonders bedingt durch meinen Vater, war nicht kirchlich. Dass ich getauft wurde, war ein Zugeständnis meines Vaters an meine Mutter. Religions- und Konfirmandenunterricht hatte ich nie. Mein Freund Rüdi, Sohn des Oberstaatsanwaltes Preuß, hatte mich im Vorschulalter einige Male mit in den Kindergottesdienst in die evangelische Kirche mitgenommen. Zwei Sachen blieben mir in Erinnerung: Weiße Bänke und der Groschen für die Kollekte. Als mein Vater von meinem Kirchenbesuch erfuhr, untersagte er mir das.
Episoden
Einige Episoden möchte ich noch nachtragen, die eigentlich isoliert von den vielen Vorgängen, die ich geschildert habe, sind, die ich aber für mitteilenswert halte, weil sie sich tief ins kindliche Gedächtnis eingeprägt haben.
Die Insassen des Meseritzer Gefängnisses fuhren in einem großen Kastenwagen – eigentlich ein eisenbereifter Pferdewagen – gehacktes Holz aus. Gezogen wurde der Wagen von den Gefängnisinsassen in Gefängniskleidung und einer entsprechenden Kopfbedeckung. Der ebenfalls in unserem Haus („Unser“ Haus ist ein Ausdruck aus unserer Kindheit, das Haus gehörte dem Staatsanwalt Dr. Ebel.) wohnende Oberstaatsanwalt Preuß stand am Fenster seiner Wohnung und sah, wie die Gefängnisinsassen durch das Tor von der Bischofstraße her das Heizmaterial für ihn brachten. Einer der Gefängnisinsassen stürzte nahezu in die Werkstatt meines Vaters, um ihn fast stürmisch zu begrü.en. Der Aufseher brachte ihn sofort zurück und kanzelte ihn mit den Worten „Sind Sie denn verrückt, oben am Fenster steht der Staatsanwalt“ ab.
Hintergrund: Der Gefangene, wie wir auch sagten, war der Fleischermeister Leschke aus Pieske, ein Jugendfreund meines Vaters und war wegen einer Schwarzschlachtung ins Gefängnis geworfen worden. Wenn ich mich recht erinnere, war wegen des gleichen Deliktes ein Bürgermeister von Meseritz in den Freitod gegangen, als er sich bei seiner Verhaftung mit der Pistole erschoss. Das war lange Stadtgespräch.
In der Freiwilligen Feuerwehr Meseritz gab es nur wenige Männer, die absolut schwindelfrei waren und deshalb auch auf die ausfahrbaren hohen Leitern klettern durften. Man nannte sie auch Steiger. Mein Vater gehörte zu ihnen, wenn ich mich recht erinnere, führte er sogar die Dienstbezeichnung „Obersteiger“. Er erzählte mir mal, wie die Steigerkandidaten u. a. getestet wurden. Sie mussten auf die höchsten Sprossen der Leiter klettern, sich dort mit ihrem Feuerwehrgurt anhaken, die Leiter stand am Rand der Pferdeschwemme, ragte soweit wie möglich über das Wasser der Obra und wurde dann bewegt. Nur wenige bestanden die Mutprobe. Als man einen Feuerwehrmann nach der Prozedur fragte, ob er denn die Hosen voll habe, bejahte er das und fügte aber hinzu: „Steiger werde ich doch.“
Die Feuerwehrhelme hatten einen ledernen Nackenschutz gegen Funkenflug und einen silbrigweiß glänzenden Kamm aus Metall, der sich von vorn nach hinten über den Helm zog. Dieser Kamm wurde während des II. Weltkrieges mit der Begründung entfernt, dass er von den Besatzungen anglo-amerikanischer Flugzeuge leicht erkennbar war und die Zielorientierung erleichterte. Ob das im Zusammenhang damit stand, dass auch Meseritzer Feuerwehrleute zur Brandbekämpfung nach Bombenangriffen auf Berlin eingesetzt waren, entzieht sich meiner Kenntnis.
Meine Kindheitserinnerungen sind Erinnerungen an die Kriegszeit. Ich wuchs auf mit den Plakaten „Pst, Feind hört mit“, mit „Verdunklung einhalten“, mit der Losung „Räder müssen rollen für den Sieg“ (wurde von den Erwachsenen ergänzt durch „Kinderwagen für den nächsten Krieg“) und der Figur des „Kohlenklau“. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 eröffnete das „Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda“ die Kampagne „Feind hört mit!“. Deren Symbol war der „Schattenmann“, der auch hier die beiden arglosen Maurer bespitzelt: Ob am Arbeitsplatz, auf der Straße oder zu Hause – überall konnte der vermeintliche Spion lauern. Ein harmloser Satz enthielt vielleicht nützliche Informationen für den Feind. Jeder Deutsche sei ein Geheimnisträger, so rechtfertigte das NS-Regime die ständige Überwachung der Bevölkerung, die tief in das Privat- Alltagsleben eingriff.
 |
| Propagandaplakate |
Die Fenster wurden mit Verdunklungsrollos versehen, damit kein Lichtschein nach draußen dringt, um den feindlichen Bombenflugzeugen die Orientierung zu erschweren. Diese Maßnahme wurde von der Polizei und den NSDAP-Blockwarten kontrolliert, Verstöße wurden bestraft. Mein Vater hat damals – wie auch die anderen Sattler in Meseritz – viele Verdunkelungsrollos angefertigt. Am Anfang verwendete man manchmal schwarzen Stoff, dann aber nur noch schwarzes, derbes Papier.
Drei Dinge sind mir im Gedächtnis haften geblieben:
Mein Vater hat mit einem Lehrling in der katholischen Kirche die riesengroßen Fenster mit Rollos verdunkeln müssen. Auf mich machte die enorm lange Leiter, die er dazu verwendete, einen großen, ja ängstlichen Eindruck. Für ihn war das aber normal, war er doch bei der Freiwilligen Feuerwehr Meseritz Obersteiger. Einmal habe ich aus den Abfällen ein kleines, funktionstüchtiges Verdunklungsrollo hergestellt, da war ich wohl 8 Jahre alt, mein Vater staunte nicht schlecht.
Die dritte Sache war unangenehmer. Als es zu dunkeln begann, gab mir meine Mutti den Auftrag, das Küchenfenster zu verdunkeln, was ich auch tat, indem ich das Verdunkelungsrollo runterzog. Was ich aber nicht wusste – meine Mutti hatte mir auch nichts gesagt, vielleicht vorausgesetzt – dass dabei auch die Jalousie heruntergezogen werden musste. Es dauerte nicht lange und ein Polizist erschien, wies darauf hin, dass aus dem Küchenfenster Licht nach draußen drang und verhängte sofort eine Geldstrafe. Mein Vater weigerte sich, die Strafe zu zahlen, der Grund war mir nicht bekannt. Ich weiß nur noch, dass er runter ging und das Fenster von außen beobachtete. Vielleicht war inzwischen auch schon die Jalousie runtergezogen, ich weiß es nicht. Jedenfalls kam er hoch und sagte, dass kein Lichtschein zu sehen war.
Einige Zeit später gab es dann ein Strafmandat mit 20 Reichsmark, die Strafe war also erhöht worden, weil mein Vater nicht gleich die verlangte Gebühr beim Polizisten bezahlt hatte. Mein Vater schob mir mit den Worten „Da hast Du Dein Strafmandat“ das Strafmandat über den Tisch. Ich fand das ungerecht, weil ich nicht wusste, dass man auch die Jalousie runterziehen musste, um eine totale Verdunklung zu erreichen.
Sogar die Fahrradlampen, damals Karbidlampen, mussten abgedunkelt werden, so dass nur ein schmaler Lichtschlitz übrig blieb. Nebenbei: Diese Karbidlampen hatten aber auch den Vorteil, dass man sie vom Fahrrad abnehmen und wie eine Taschenlampe benutzen konnte. So hat übrigens mein Vater Regenwürmer für seine Angelei gesucht.
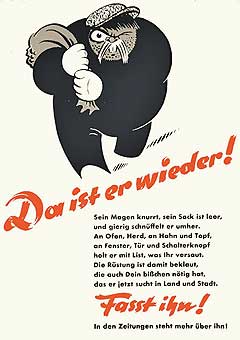 |
| Kohlenklau-Propagandaplakat |
Vom Kohlenklau gab es auch ein Brettspiel, das so ähnlich wie „Mensch ärgere Dich nicht“ aufgebaut war, es hieß „Jagd auf Kohlenklau“. Wir haben es als Kinder sehr oft gespielt. Das Spiel besteht aus einer relativ dünnen Pappe im DIN-A3 Format. Auf dem Weg zum Ziel mussten die Spieler sich in fünfzig Schritten als würdige Energiesparer erweisen. Es gab drei verschiedene Arten von Feldern. 21 Felder waren neutral, 12 Felder rot (Energie verschwendet), 15 Felder schwarz (vorbildhaftes Verhalten).
Sehr viel habe ich mit Rüdiger Preuß gespielt, wir waren nahezu unzertrennlich, beide Jahrgang 1936. Da die Familie des Oberstaatsanwaltes Preuß eine größere Wohnung als wir hatte, haben wir dort fast immer gespielt. Rüdi hatte viel mehr Spielsoldaten als ich, vor allem auch französische und englische Soldaten (die ich nicht hatte), außerdem auch Handgranaten werfende Soldaten und Soldaten in verschiedenen Stellungen – liegend, kniend, stehend, schießend. Meine Spielsoldaten konnten nur marschieren. Bei unseren Spielen haben „natürlich“ immer die deutschen Soldaten gewonnen. Wir spielten auch mit Kanonen, die hinter Zugmaschinen gehängt wurden, und mit Panzern, die aufgezogen werden mussten und dann eine Strecke fuhren. Einige Typen hatten – ähnlich wie beim Feuerzeug – Funken sprühende Kanonenläufe bzw. MG’s. Rüdi hatte zwei ältere Brüder, die beide ins Gymnasium Meseritz gingen. Bei ihnen sah ich zum ersten male lateinische Texte, nicht ahnend, dass ich später auch einmal das Fach Latein in der Schule haben würde.
Wolfgang, der ältere Bruder, wurde dann als Marinehelfer eingezogen. Ulrich; Jahrgang 1929, hat sich viel mit uns jüngeren Kindern beschäftigt, fast wie ein älterer Bruder. Bedingt durch die kriegerische Erziehung in der HJ hatte er schon im Jahr 1944 eine Pistole, mit der in unserer Gegenwart – ungeladen - herumhantierte. Als ich ihn einmal fragte, was er denn mit der Pistole wolle, antwortete er mir: „Wenn die angloamerikanischen Fallschirmspringer kommen, stelle ich mich auf den Balkon und schieß sie ab.“ Ulrich überlebte schwerverletzt das Inferno von Gleißen, wo viele Hitlerjungen ihr junges Leben lassen mussten.
„Räder müssen rollen für den Sieg!“, diese Propagandalosung gab es ab 1. Juni 1942. Da ich am 1. September 1942 in die Schule kam, war diese Losung einer der ersten Sätze, die ich lesen konnte. Sie war an Bahnhöfen und Lokomotiven angebracht.
An die Bevölkerung wandten sich Motive, die zum Verzicht auf Privatreisen aufforderten. Zeichnungen von Soldaten auf Reisen wurden dabei umrahmt von Aufforderungen wie: „Er geht vor! Verzichte Du! – Jeden Platz für Fronturlauber!“, „Wehrmacht geht vor! Verzichte Du auf die Weihnachtsreise!“ und „Erst siegen – dann reisen!“. Im Rahmen der Kampagne erschien eine Serie von Anzeigen mit verschiedenen Motiven. Die meisten dieser Darstellungen forderten den Leser dazu auf, unnötige Reisen zu unterlassen. So zeigte ein Motiv ein Zugabteil, in dem ein Soldat in Marschausrüstung vor einem sitzenden, dämonisierten Reisenden steht. In großen Lettern war darüber geschrieben: „Hilft Deine Reise siegen?“, verbunden mit der Unterzeile „Musst Du der Front Wagenraum stehlen?“.
Am 20. April, dem Geburtstag des Führers Adolf Hitler, musste immer die Hakenkreuzfahne rausgehängt werden. Übrigens kam man schon ins KZ (Konzentrationslager), wenn man sich weigerte, eine Hakenkreuzflagge zu hissen. Später hat mir mein Vater mal erzählt, dass er am Anfang keine Hakenkreuzfahne hatte. Da die NSDAP-Blockwarte am 20. April kontrollierten, wer keine Fahne rausgehängt hatte, kam er in arge Bedrängnis, zumal er auf Grund seiner Tätigkeit in der SPD vor 1933 in Meseritz als der „rote Kintzel“ galt.
Nun übertrumpfte er sie alle und hatte in der Kirchstraße die größte Fahne. Während der Zeit, in der die Fahne gehisst wurde, musste wegen der langen Fahnenstange in der Wohnstube das Fenster offen bleiben. Bei mir verbindet sich daran die Erinnerung immer mit einer kalten Stube, denn am 20. April konnte es noch ganz schön kalt oder kühl sein.
Mit Begeisterung spielten wir Indianer und Trapper, aber noch mehr Soldaten und Krieg. Das wurde sicherlich auch dadurch katalysiert, dass es in Meseritz eine Kaserne gab.
Zur Verteidigung des Obra-Warthe-Bogens (Ostwall) wurde im Oktober 1937 das Grenz-Infanterie- Regiment 122, das nachherige Infanterie- Regiment 122, aufgestellt, sein Standort war Meseritz. Die Soldaten marschierten immer mit Gesang – ich erinnere mich noch an „Kehr ich einst zur Heimat wieder“ (Schlesierlied), „Auf der Heide blüht ein Blümelein“, „Oh, Du schöner Westerwald“ und „Einen Heller und einen Batzen“ - durch die Stadt. Wir marschierten hinterdrein – mit selbstgeschnitztem Holzsäbel und Holzgewehr. Einmal durften wir sogar in der Formation mitmarschieren, da sind wir fast vor Stolz geplatzt.
In der Obra, an der Pferdeschwemme, ritten die Soldaten mit den Pferden ins Wasser, um die Pferde zu waschen. Das war natürlich für uns eine Gaudi, da mussten wir unbedingt hin. Oftmals sind wir auch zum Güterbahnhof gegangen, wenn dort Soldaten und Kriegsgerät verladen wurden. Eine solche Verladung hat mir noch tagelang Gewissensbisse gebracht. Ein Soldat gab mir etwas Geld und ich sollte ihm irgendetwas kaufen. Ich bekam aber nicht das Gewünschte. Als ich wieder am Bahnhof ankam, war der Zug mit den Soldaten schon weggefahren, und ich hatte noch das Geld, das mir nicht gehörte. Ich kam mir wie ein Dieb vor. Ich glaube, ich habe es dann auf ein Anraten für das WHW (Winterhilfswerk) gespendet. Irgendwann verbreitete sich unter uns Kindern die Nachricht, dass auf einem Abstellgleis russische Beutepanzer stehen. Sofort rannten wir hin und krochen in die Panzer.
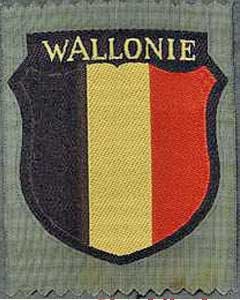 |
Der auf dem Pferd vorweg reitende Offizier fiel in Höhe des Kaiser-Wilhelm-Denkmals vom Pferd und zog sich an der Wange eine Schramme zu. Bestieg dann wieder sein Pferd und ritt weiter. Soweit das Erlebnis. Zu Hause erzählte ich das meinem Vater, der sich ganz verwundert äußerte, dass einem Ungarn, Angehörigen eines „Reitervolkes“, so etwas passieren konnte.
An die Wallonen mit ihrem charakteristischen Abzeichen an der Uniform (Oberarm) kann ich mich deswegen gut erinnern, weil das Dienstmädchen vom Uhrmacher Handke einen wallonischen Freund hatte, der dann öfter in die Kirchstraße 16 kam.
Zeitweilig müssen Angehörige der Wallonischen Legion in der Kaserne Meseritz stationiert gewesen sein.
In den 1930er Jahren wurde mit dem Bau des Ostwalls begonnen. Die Linienführung entsprach in etwa der Linie Nischlitz-Obra und lag ca. 20 bis 25 km hinter der Grenze.
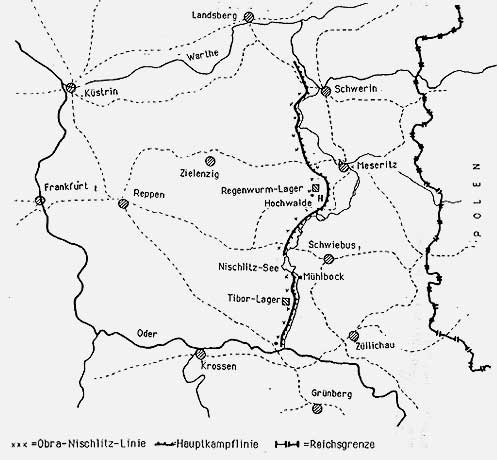 |
| Lage des Ostwalls bei Meseritz (Oder-Warthe-Bogen) |
Die „Bunkerlinie“, wie die Meseritzer sie nannten, spielte im Denken und Handeln der Menschen in den Januartagen 1945 eine besondere Rolle, weil die Menschen glaubten, hinter der Bunkerlinie vor den Russen sicher und geschützt zu sein.
Meine Mutti fuhr liebend gern mit der Eisenbahn oder mit dem Bus. Eines Tages (1943 oder 1944?) fuhren meine Mutti und ich mit dem Bus über Nipter in die Nähe der Bunkerlinie. In einem Dorf kontrollierte ein Soldat den Bus und verfügte „Die Frau mit dem Kind muss aussteigen“, der Bus fuhr dann in die unmittelbare Nähe der Bunkerlinie, wahrscheinlich ins Regenwurmlager. Als er auf der Rücktour in dem Dorf, Namen weiß ich nicht, wieder hielt, durften wir wieder einsteigen und zurück nach Meseritz fahren.
Bei Fliegeralarm hasteten die Einwohner der Kirchstraße 16 in den Keller, der als „Luftschutzkeller“ deklariert worden war. Jeder hatte einen kleinen Koffer oder ein anderes Utensil, in dem sich wichtige Sachen befanden, mit in den Keller zu nehmen. Im Keller saßen wir auf primitiven Holzbänken dann solange, bis der Sirenenton „Entwarnung“ ertönte, dann gingen wir wieder in unsere Wohnung.
Ich hatte meinen Vater einmal gefragt, als wir im Keller waren, ob denn durch die Kellerdecke keine Bomben durchkommen würden. Noch heute sehe ich, wie mein Vater zu dem Kellergewölbe, etwas bogenförmig und weiß gekalkt, mit der Hand deutete und erklärte, dass durch dieses Gewölbe keine Bombe durchkommen könne, wir also ganz sicher im Keller sein können. Ob mein Vater mir das nur sagte, um mich zu beruhigen oder ob er das selbst auch geglaubt hatte, weiß ich nicht.
Wie das bei Kindern ist, wenn der Vater im Brustton der Überzeugung erklärt, es ist wie das „Evangelium“. Ich war mir also sicher, vielleicht zu selbstsicher, denn das zeigte mir die Äußerung meiner Mutter. Meine Eltern waren mit mir für ein paar Tage in Berlin bei meiner Schwester gewesen. In der Nacht nach unserer Abfahrt gab es dort einen Bombenangriff. Meine Mutter meinte, dass ich das mal miterleben müsste, damit ich nicht immer solch großen Mund habe.
Pfingsten 1944 (29. Mai 1944) flog bei herrlich blauem Himmel ein amerikanischer Bomberverband in Ostrichtung über Meseritz. Der Bomberverband wurde von deutschen Jagdflugzeugen angegriffen.
Die Einwohner der Kirchstraße 16 standen auf dem Hof und schauten zum Himmel. Plötzlich rief Rose, das Dienstmädchen vom Uhrmachergeschäft Handke: „Da brennt ja ein Flugzeug!“ Flugzeugteile trudelten herab und weiße Fallschirme blähten sich wie kleine Segel am Himmel auf. Bald darauf rückten die Soldaten aus der Kaserne aus und suchten die Abgesprungenen. Am späten Nachmittag kehrten die deutschen Soldaten zurück, wir sahen sie vom Balkon der Familie Preuß auf der Kirchstraße in Richtung Kasernen marschieren, Gefangene von der Flugzeugbesatzung sahen wir nicht. Soweit meine persönliche Erinnerungen.
Dem Internet konnte ich folgenden Bericht entnehmen. „Am 29. Mai 1944 starteten von verschiedenen Flugplätzen in England fast 1000 schwere Bomber und über 600 Begleitjäger der amerikanischen Achten Air Force mit dem Befehl der Bombardierung von Zielen in Deutschland. 149 B-17 G - Bomber der 1. Bomb Division, sogenannte „Fliegende Festungen“, bombardierten die Focke-Wulf Werke in Posen und den naheliegenden Flugplatz Kreising, 52 weitere flogen nach Sorau, 48 nach Cottbus und 19 nach Schneidemühl.
Nach Abwurf der Bombenlast flogen die Bomberpulks nicht unmittelbar zurück nach Westen, sondern nahmen nördlichen Kurs ein. Der Rückflug nach England sollte über die sichere Ostsee geschehen.
Während des Rückfluges wurde die Einheit von deutschen Focke-Wulf 190 Jägern angegriffen, es kam zu einem großen Luftkampf. Dabei wurden zwei „Fliegende Festungen“ abgeschossen, eine stürzte bei Janau ab, ein Besatzungsmitglied kam dabei ums Leben, der Rest wurde festgenommen. Der zweite Bomber kam unweit Prittisch herunter, die Besatzung wurde ebenfalls gefasst. Diese zwei Abschüsse musste die deutsche Luftwaffe teuer bezahlen - acht deutsche Jagdflugzeuge wurden abgeschossen, nur drei Piloten überlebten. Eines dieser Flugzeuge musste hinter der Kaserne notlanden, die restlichen stürzten in der näheren Umgebung von Meseritz ab.“ Zum Glück gab es auf Meseritz keine Bombenangriffe.
 |
| Propagandaplakate |
In den Wintermonaten wurde eine Straßen- und Haussammlung im Rahmen des Winterhilfswerkes (WHW) durchgeführt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich auf der Kirchstraße in die rote Büchse Geld reingesteckt habe. Dafür gab es dann Abzeichen wie Märchenfiguren, Abbildungen von Städten, Wappen, Toren, die bei uns Kindern begehrt waren und auch als Tauschobjekte fungierten.
Eine andere Propagandaaktion war der Eintopfsonntag. Er fand erstmalig am 1. Oktober 1933 statt und wiederholte sich jeweils am ersten Sonntag der Monate Oktober bis März.
In allen deutschen Haushalten durfte nur Eintopf gegessen werden. Die Bevölkerung und die Restaurants waren auf Anordnung der Reichsregierung verpflichtet, nur einfache Eintopfgerichte zu verzehren bzw. anzubieten, deren Preis pro Kopf eine halbe Reichsmark nicht überschreiten sollte. Die Differenz zwischen den Kosten für das sonst übliche Sonntagsessen und dem für Eintopf nötigen Aufwand, „von oben“ generell mit 50 Pfennig veranschlagt, wurde von den von Tür zu Tür gehenden Blockwarten der NSDAP kassiert und kam dem kurz zuvor gegründeten Winterhilfswerk zugute.
In den Zeitungen wurden wiederholt Eintopfrezepte als Vorschläge veröffentlicht; es erschien auch ein Eintopf-Kochbuch. Regional wurde vorgeschrieben: „Für den 14. Oktober sind lediglich folgende drei Eintopfgerichte zugelassen: 1. Löffelerbsen mit Einlage; 2. Nudelsuppe mit Rindfleisch; 3. Gemüsetopf mit Fleischeinlage (zusammengekocht). Zu Löffelerbsen ’Einlage’ entweder Wurst, Schweineohr oder Pökelfleisch.“ An den „Eintopfsonntagen“ veranstaltete die NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) in den Städten Gemeinschaftsessen auf öffentlichen Plätzen.
Ich kann mich noch sehr genau an eine lange Tafel auf dem Marktplatz von Meseritz erinnern. Zugegen waren auch stets Repräsentanten der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), um die Bedeutung der „Eintopfsonntage“ zu unterstreichen.
An solchen Veranstaltungen nahm die Familie Kintzel nie teil, sicher eine bewusste Haltung, die von meinem Vater ausging.
 |
| Propagandaplakate |
Die Reichskleiderkarte wurde nach der Einführung der Lebensmittelkarten (28.8.1939) am 14.11.1939 eingeführt. Sie war ein Bezugsschein für den Einkauf von Textilien. Der Bezugsschein bestand aus 100 Punkten, die beim Kauf von Textilien abgerechnet wurden. Ein Paar Strümpfe „kostete“ 4 Punkte, ein Pullover 25 Punkte, ein Damenkostüm 45 Punkte. Die Reichskleiderkarte galt nur für Kleidung, während Tisch-, Haus- und Bettwäsche sowie Schuhe und Berufskleidung mit gesonderten Bezugsscheinen zugeteilt wurden.
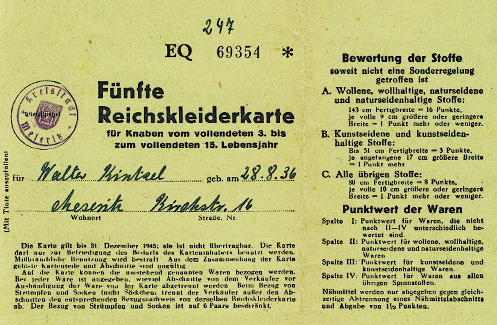 |
| Reichskleiderkarte von mir |
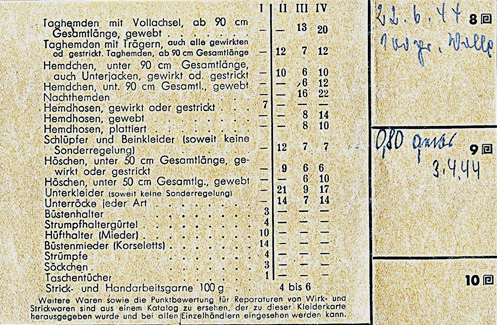 |
| Reichskleiderkarte meiner Mutter mit Eintragungen |
Meine Oma und meine Tante Frieda, die auf der Winitze wohnten und Vieh hielten (Ziegen, Gänse, Hühner), mussten Hühnereier abliefern. Das war nach der Anordnung über Eierablieferung vom 15. 12. 1941 streng reglementiert, so z. B. pro Huhn 60 Eier jährlich; ich glaube, die Hühner legten damals so etwa 260 Eier im Jahr. Meine Tante Frieda führte über die Legeleistungen genau Buch. Abzuliefern nach der Anordnung über die Eierablieferung waren 40 Eier vom 1. 10. 1942 bis 31. 5. 1943, 20 Eier vom 1. 6. 1943 bis zum 30. 9. 1943. Meine Tante legte die Eier in einen Weidenkorb, der mit Stroh ausgepolstert war, um sie zu einer Sammelstelle zu bringen. Ich wollte auch so gern die Eier in den Korb legen, durfte das aber nicht, weil meine Tante Befürchtungen hatte, dass ich dabei Eier beschädigen würde.
Ich konnte schon fließend lesen (1942 wurde ich eingeschult), als ich bei meiner Tante (1944?) ein Schriftstück las, das sich mit dem Endsieg befasste. Eine Sache hat mich damals beeindruckt, weil sie nach meinen kindlichen Maßstäben weit in die Zukunft hineinragte. Nachdem dort zu lesen war, wie und wann der Krieg mit den Anglo-Amerikanern beendet werden würde, stand da die Aussage „1946 werden wir mit den Russen fertig sein.“ Das war für mich als Kind ein unermesslich großer Zeitraum; wer hätte geahnt, dass wir 1946 gar nicht mehr in unserer Heimatstadt sein würden?
Es muss im Jahr 1944 gewesen sein, als mein Freund Rüdi Preuß und ich uns in der Buchhandlung ein deutsch-russisches Wörterbuch gekauft haben. Mir ist so, als sei dieses Taschenbüchlein für die deutschen Soldaten verfasst worden. Die erste Redewendung, die wir lernten, war „ruki werch“, zu Deutsch: „Hände hoch“, also die Aufforderung, sich zu ergeben. Verblendet!
Eine Zeitlang spielten wir mit Spiegeln der NSDAP und SA – welcher Spielkamerad die mitgebracht hatte, weiß ich nicht mehr - und mit Papierfähnchen mit dem Hakenkreuz. Meinen Eltern, insbesondere meinem Vater, passte das sicherlich nicht, ein förmliches Verbot konnte er mir aber nicht aussprechen, das war zu gefährlich.
Doch plötzlich brachte meine Schwester aus Berlin, Olympiafähnchen mit, die übrigens nicht aus so dünnem Papier wie die Hakenkreuzfahnen bestanden, also haltbarer waren. Die Olympiafähnchen waren beim Spielen unter uns Kindern sehr begehrt. Es hieße, meinen Vater nicht gut zu kennen, wenn ich vermute, dass er nicht dahinter stand.
 |
Wer das Abzeichen nicht trug, konnte dafür mit bis zu 6 Wochen Haft bestraft werden. Die Stigmatisierung der polnischen Arbeitskräfte, die als Zwangsarbeiter ins Deutsche Reich verschleppt worden waren, erfolgte am 8. März 1940 durch ein umfangreiches Erlasswerk zur Regelung der Arbeitsund Lebensbedingungen der polnischen Zivilarbeiter, den „Polen- Erlassen“.
Die Erlasse bestimmten für die polnischen Zivilarbeiter:
ein nächtliches Ausgehverbot, ein Verbot der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel außerhalb des Arbeitsortes, ein Verbot des Besuchs deutscher Veranstaltungen kultureller, kirchlicher und geselliger Art sowie ein Verbot des Besuchs von Gaststätten.
In einem Merkblatt an die polnischen Arbeiter hieß es: „Wer lässig arbeitet, die Arbeit niederlegt, andere Arbeiter aufhetzt, die Arbeitsstätte eigenmächtig verlässt usw. erhält Zwangsarbeit im Konzentrationslager... Wer mit einer deutschen Frau oder einem deutschen Mann geschlechtlich verkehrt, oder sich ihnen sonst unsittlich nähert, wird mit dem Tode bestraft“.
Fragen dazu haben wir als Kinder nicht gestellt. Der Friseur Schechner, der in unserem Haus wohnte, hatte eine Polin als zwangsverpflichtete Arbeitskraft. Sie hieß Hedwig und war schon etwas älter. Wir Kinder haben sie auf dem Hof, wenn wir sie getroffen haben, genauso freundlich wie die übrigen Erwachsenen im Haus gegrüßt. Gespräche führten wir auch mit ihr.
Mir ist ein Gespräch mit ihr aus dem Winter 1943/44 im Gedächtnis, als sie zu mir nach Schneefall sagte, dass ich mich doch freuen würde, weil ich nun – sie meinte sicher „Schneebälle“ – „Schneekugeln“ machen könnte. Der Ausdruck „Kugel“ war mir zu kriegerisch, und ich dachte so bei mir, warum sagt die Polin das? Jahrzehnte später als Erwachsener kam ich zu dem Schluss, dass es einfach eine Sache der Vokabeln war, ohne jeden Hintergrund. Ich habe auch nie einen herabwürdigenden Satz der Hausbewohner über Hedwig gehört oder gar eine Aufforderung, mit ihr nicht zu sprechen. Sie hat es uns allen in der Russenzeit vergolten, blieb auch noch bis zum Tag der Vertreibung am 26. Juni 1945 bei der Familie Schechner.
Ich habe schon sooft darüber nachgedacht, wie es wohl gewesen wäre, wenn man nach dem verbrecherischen Krieg mit ihr in Verbindung getreten wäre und Gedanken ausgetauscht hätte. Zwar waren wir „sozialistische Brudervölker“, aber der private Kontakt wurde von den staatlichen Stellen unterbunden.
 |
Es markierte den Höhepunkt der 1933 begonnenen, nun öffentlich sichtbaren sozialen Ausgrenzung, Diskriminierung und Demütigung der jüdischen Mitbürger. Gleichzeitig diente es ihrer Auffindung für die damals beginnenden planmäßigen Judendeportationen in die Ghettos und Konzentrationslager und schließlich in die Vernichtungslager in Osteuropa. Der Judenstern war damit eine sichtbare Maßnahme zur Durchführung des Holocausts.
Neue Gesetze und Verordnungen hatten entwürdigende Auswirkungen auf das Leben der Juden. Durch Berufsverbote und Enteignungen von Betrieben wurde ihre wirtschaftliche Existenz nach und nach vernichtet.
Sie wurden aus dem öffentlichen Leben verdrängt: Für Juden bestanden Ausgehbeschränkungen, das Betreten von Theatern, Kinos oder Museen war ihnen verboten. Kinder durften keine öffentlichen Schulen mehr besuchen und mussten ab dem 6. Lebensjahr den Judenstern tragen.
Auf Parkbänken prangte die Aufschrift „Nur für Arier“, an den Eingängen zu Restaurants hingen Schilder mit der Warnung „Juden sind hier unerwünscht“. Juden mussten einen Zwangsvornamen annehmen. Männer erhielten den Zusatz „Israel“, Frauen den Namen „Sara“.
Da ich viel in der Werkstatt meines Vaters war, ist mir eine Begegnung eines jüdischen Mitbürgers mit meinem Vater in Erinnerung geblieben. Leider weiß ich nicht mehr den Namen des jüdischen Mitbürgers (nach meiner Erinnerung ein älterer Mann), der eines Tages zu meinem Vater kam und mit dem Satz „Meester, ich brauche einen großen Rucksack“ sein Begehr vortrug.
Mein Vater fertigte den Rucksack an. Zufällig war ich wieder in der Werkstatt, als der Mann den Rucksack abholte. „Vater (Namen?), da kriegen Sie aber viel rein, „ sagte mein Vater und übergab ihm den Rucksack, ließ sich die Arbeit nicht bezahlen. Der Mann war durch die Vorderfront des Grundstückes, also von der Kirchstraße, über den Hof in die Werkstatt gekommen. Das Grundstück verließ er durch das Tor zur Bischofstraße. Zufall?
2004 habe ich erfahren, dass Angehörige der HJ und des BDM sensationslüsternd in die Kellerluken des Rathauses schauten, als im Rathauskeller Juden eingesperrt waren. Unser Hausarzt hatte sich darüber empört geäußert und seinen Kindern ein solches Tun strengstens untersagt.
Volkssturm
Im September 1944 wurde der „Volkssturm“ gebildet, um alle bisher noch nicht kämpfenden waffenfähigen Männer zwischen 16 und 60 Jahren für die Verteidigung des „Heimatbodens“ und für den deutschen „Endsieg“ aufzubieten.
Der unter dem militärischen Befehl Heinrich Himmlers stehende „Volkssturm“, dessen Angehörige als äußeres Kennzeichen eine Armbinde mit der Aufschrift „Deutscher Volkssturm - Wehrmacht“ trugen (s. Abb.), war vor allem für Bau - und Schanzarbeiten, Sicherungsaufgaben sowie zur Verteidigung von Ortschaften – meist in unmittelbarer Heimatgegend - vorgesehen.
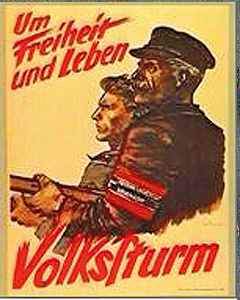 |
|
Deutsches Propagandaplakat für den Eintritt in
den Volkssturm Herausgeber: Reichspropagandaleitung |
Auf dem Sportplatz in Meseritz wurden die Volkssturmmänner vereidigt. Zu der Vereidigung ging ich mit meinem Spielkameraden hin, woher die Anregung dazu kam, weiß ich nicht. Es gab zwei Vereidigungen (Aufgebot 1 – feierliche Vereidigung am Sonntag, dem 12. September 1944 - und Aufgebot 2). Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die zweite (November ?1944) bei nasskaltem Wetter erfolgte, ich fror damals sehr.
Ich bin ein eifriger Zeitungsleser, vielleicht hat sich das damals schon angebahnt. In der „Berliner Illustrierten“ las ich über den Volkssturm und sehe das Foto noch ganz zeitnah vor mir, wie deutsche Soldaten und der Volkssturm ein Gefecht führen, wobei sie von einem Panzer absprangen. „Panzer mit aufgesetzter Infanterie“ faselte die Kriegspropaganda immer.
Schulzeit in Meseritz (1942 – 1945)
Am 1. September 1942 wurde ich in die Volksschule Meseritz eingeschult. Die Schule war ein neuer und großer Bau. Links war die Knabenschule, rechts die Mädchenschule, damals wurden Jungen und Mädchen noch getrennt unterrichtet. Sehr bald wurde die Schule aber zum Lazarett umfunktioniert, 1943 wurde dort ein Reservelazarett, also ein Heimatlazarett, eingerichtet, und zwar zunächst als eine Außenstelle für leicht Verwundete des Lazarettes Schwiebus.
Viele Erinnerungen an diese Volksschule Meseritz habe ich nicht. Meine Mutti hatte mich zur Einschulung gebracht. Ich war verwundert, dass mein Vater nicht mit kam. Immerhin war er mit mir zur Schuluntersuchung gegangen. Hatte er so viel in seinem Beruf zu tun? Es war immerhin ein Werktag. An der Tafel war eine farbige Zeichnung, u. a. eine Wald-Erdbeere. Da ich mit meinem Vater zum Angeln öfter mitgefahren war und auch welche dort im Wald gesammelt hatte, erkannte ich sie sofort.
In der Schule muss ich recht gut gewesen sein, denn mein Vater war mit dem Zeugnis der 1. Klasse so zufrieden, dass er mir 20 Reichsmark (RM) schenkte, damals sehr viel Geld. Vielleicht hatte er es nicht erwartet und war überrascht, ich weiß es nicht. Leider ist mir ja meine Schultasche mit Fotoalben und Zeugnissen im Juni 1945 bei der Vertreibung aus Meseritz von den polnischen Uniformierten geplündert worden. Das Zeugnis nach der 2. Klasse muss weniger gut ausgefallen sein, denn da war mein Vater nicht so spendabel, was ich aber anders erwartet hatte.
In den Schuljahren in Meseritz gab es auch noch etwas mit dem Rohrstock, gelegentlich hatte es mich auch erwischt, aber das ertrug man „mannhaft“. „Gelobt sei, was hart macht.“ Da das damals gang und gäbe war, machte man davon auch kein Aufhebens.
Von einem Mitschüler, der Hannewacker hieß, bekam ich einmal einen Hieb auf die Nase, so dass die sehr stark blutete. Anstatt etwas dagegen zu tun, ließ ich das Blut auf mein weißes Hemd auf dem Nachhauseweg – Kopf runter – laufen.
Wir neckten ihn immer mit „Hannewacker, Hosenkacker“, bei einem Rundumschlag traf es mich.
Das war noch in der 1. Klasse, ansonsten kann ich mich aber an Prügeleien unter uns Schülern nicht erinnern.
 |
| Volksschule Meseritz (Archiv HGr) |
Herr Zahn, Klassenlehrer in der 1. Klasse, legte großen Wert darauf, dass auch das „Z“ als solches deutlich gesprochen wurde; Schüler die ihn mit Herr Sahn anredeten, bekamen schnell seinen Unmut zu spüren.
Jeder Schüler, der Geburtstag hatte, bekam von ihm immer einen blanken Groschen (= 10 Pfennige) geschenkt. Da ich in den Ferien Geburtstag hatte, traf das auf mich nicht zu. Mir ist aber noch im Gedächtnis haften geblieben, wie ein neben mir sitzender Mitschüler eines Tages zu mir sagte: „Du, sag doch mal Herrn Zahn, ich habe heute Geburtstag“. Ihm ging es also um den blanken Groschen, den Herrn Zahn in solchen Fällen aus seinem Portemonnaie nach einer kleinen Suchpause hervorkramte. Ich meldete mich also und sagte das Herrn Zahn. Der wandte sich sofort etwas barsch an den Schüler mit der Bemerkung „Du hast doch neulich erst Geburtstag gehabt, man hat nur einmal im Jahr Geburtstag.“
Das war mir dann doch etwas peinlich. Ich habe Herrn Zahn in guter Erinnerung.
Er ist im Dezember 1945 in Karelien als Verschleppter elend zugrunde gegangen. Es gibt einen Bericht einer Augenzeugin, die ihn dort getroffen hat, der er klagte, dass er so friere. Er war damals schon 63 Jahre alt. Aus welchem Grunde gerade er verschleppt worden ist, weiß ich nicht, offensichtlich war es schiere Willkür.
Im zweiten Halbjahr hatten wir Unterricht in einem Betsaal der Neuapostolischen Gemeinde (?) neben dem Feuerwehrdepot.
Was mich als Schulkind in der 1. Klasse sehr beeinflusst hat, war das tragische Schicksal meines Mitschülers Adolf Fiedler. Sein älterer Bruder hatte mit einer deutschen Eierhandgranate gespielt, die dabei explodierte. Die Mutter wurde getötet, ein anderer Bruder auch, ein Bruder verlor bei der Explosion ein Bein, ein weiterer einen Arm, mein Klassenkamerad wurde leicht an der Wange verletzt. Es wurde damals erzählt, dass der Junge, der die Eierhandgranate gefunden hatte, einen deutschen Soldaten gefragt habe, ob er die mitnehmen könne, was der Soldat bejaht haben soll. Der Tod der Mutter hat mich sehr bedrückt und traurig gestimmt. Ich habe zeitlebens zu Menschen – besonders bei Schülern, die ich unterrichtete - die ihre Mutter während der Kindheit verloren haben, ein tiefes Mitgefühl gehabt.
Von der Schule wurden wir angehalten, Altstoffe zu sammeln (Lumpen, Papier usw.). In der Schule gab es dann dafür Punkte. Von meinem Vater bekam ich die alten Polsterbezüge, die er beim Aufarbeiten von Polstermöbel nicht mehr gebrauchen konnte, dazu kamen noch die Papierabfälle von den Verdunklungsrollos.
Einmal hatte ich so viel Material, dass ein Lehrling von meinem Vater die Sachen in die Schule brachte, weil ich das gar nicht tragen konnte. Ich weiß noch, dass Horst Slawinski, Sohn eines Schuhmachers aus der Schulstraße, und ich die ungekrönten Könige waren und als einzige über 100 Punkte hatten, während die anderen Mitschüler weit darunter lagen. Wenn ich mich nicht sehr täusche, hatte Horst 124 und ich 117 Punkte.
Im 2. Schuljahr wurde meine Klasse im Gymnasium unterrichtet, in der 3. Klasse fand der Unterricht in einer Baracke am Grenzlandhaus statt.
In der 2. Klasse bei Herrn Albert Bresch bekamen wir fast täglich in Deutsch die Aufgabe „20 Wörter aufzuschreiben“. Der Terminus liegt mir noch heute im Ohr. Im Nachhinein kann ich mich ganz schwach erinnern, dass es mal 20 Wörter mit demselben Anfangsbuchstaben waren, vielleicht auch 20 Wörter zu bestimmten Sachgebieten. Musikunterricht hatten wir eigentlich nicht, es wurde nur gesungen, vor allem Kriegslieder, besonders in der 3. Klasse. Lag es an der jungen Lehrerin, Fräulein Schumann? Hatten die alten Lehrer, Herr Zahn (1. Klasse) und Herr Bresch (2. Klasse), sich dieser Sache entzogen oder galt solch Musikunterricht mit Gesang erst ab der 3. Klasse?
Ich meine, wir hätten in den ersten beiden Klassen nur das Lied vom guten Kameraden gesungen. Ich wunderte mich als Schulkind immer über das Wort „nit“.
Ich hatt’ einen Kameraden,
Einen bessern findst du nit.
Die Trommel schlug zum Streite,
Er ging an meiner Seite
In gleichem Schritt und Tritt.
Von der HJ (Hitler-Jugend) hörten wir ihr Pflichtlied, wenn eine HJ-Formation durch Meseritz marschierte. Ich meine, wir hätten es auch in der Schule gesungen.
Ein junges Volk steht auf, zum Sturm bereit!
Wir fühlen nahen unsere Zeit,
die Zeit der jungen Soldaten.
Der Text des Russlandliedes ist mir noch im Gedächtnis:
Wir standen für Deutschland auf Posten
und hielten die große Wacht.
Nun hebt sich die Sonne im Osten
und ruft die Millionen zur Schlacht.
Refrain:
Von Finnland bis zum Schwarzen Meer:
Vorwärts, vorwärts!
Vorwärts nach Osten, du stürmend’ Heer!
Freiheit das Ziel, Sieg das Panier!
Führer, befiehl!
Wir folgen dir!Aus dem Lied „Nur der Freiheit gehört unser Leben“ ist mir der folgende Zweizeiler im Gedächtnis geblieben. Mir gefielen der Text und auch die Melodie. Allerdings hatte ich gemeint, dass es „…ist die Welt noch mein“ hieße. Ob wir das in der Schule gesungen haben, kann ich nicht mehr sagen, aber ich habe es bestimmt vom marschierenden Jungvolk und der HJ gehört.
Freiheit ist das Feuer, ist der helle Schein,
so lang sie noch lodert, ist die Welt nicht klein.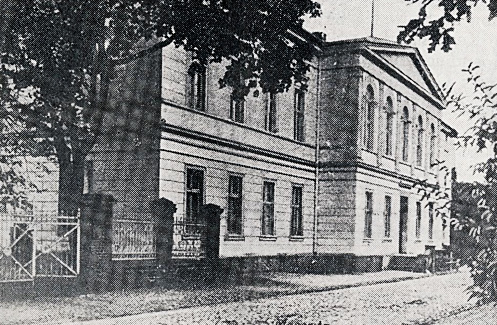 |
| Gymnasium Meseritz (Archiv HGr) |
Seltsamerweise erinnere ich mich an die 3. Klasse weniger als an die 1. Klasse, obwohl doch die Eindrücke aus der 3. Klasse jünger sind. Ich weiß nur noch, dass wir Kleiderwache hatten. Jede Stunde wurde mit dem Hitlergruß eröffnet.
Die Lehrerin, Fräulein Schumann, war schätzungsweise Anfang der 20er Jahre. Eine Sache war mir peinlich: Ich stand mit Gerhard Wundersee, einem Lehrling meines Vaters, gegenüber dem Gymnasium am Parkrand, als meine Klassenlehrerin mit dem Fahrrad von der Schule kam.
Ich stellte mich – wie es uns gelehrt worden war – an den Straßenrand und hob meinen rechten Arm zum Hitlergruß.
Als sie vorbei war, fragte mich der Gerhard, wer das gewesen sei. Ich sagte es ihm. Er pfiff hinter der Lehrerin her und rief auch noch etwas. Das war für mich ungewohnt, peinlich und ich hatte Befürchtungen für den kommenden Tag. Es kam aber nichts, ich war erleichtert.
Am Grenzlandhaus befand sich nach der Kapitulation Italiens (September 1943) vorübergehend ein kleines Gefangenenlager mit italienischen Soldaten. Wir standen am Stacheldraht und die italienischen Soldaten zeigten uns ihr Geld, ich meine, sie wollten es mit uns gegen deutsches Geld tauschen, aber wir hatten ja kein Geld. Für mich war das alles komisch, hatte ich doch immer gelesen, dass die Italiener „unsere Verbündeten“ seien.
Mir ist so, als sei ich in der 3. Klasse nicht gut gewesen, vielleicht war die lange Pause (Januar bis September 1945) eine „schöpferische Unterbrechung“ gewesen, die sich für mich gut ausgewirkt hat, aber genau weiß ich das nicht.
Auch wir Kinder wurden dazu angehalten, Verdächtiges zu melden und auf Spione zu achten. Als ich einmal – wahrscheinlich im Sommer 1943 oder 1944 – an der Obra auf der Seite der Winitze, wo meine Großeltern Päch wohnten, einen Mann beobachtete, der die gegenüber liegende Seite der Obra mit Rathaus und evangelischer Kirche in einer Federzeichnung festhielt, meinte ich, das sei ein Spion. Ich überlegte, ob ich den nicht bei der Polizei melden müsse, weil er Vorarbeiten für eine Bombardierung leistete. Ich habe es aber dann gelassen.
In der Schule, das war damals eine Baracke, hatten wir abwechselnd Dienst und mussten, während die anderen Schüler Unterricht hatten, auf den Fluren patrouillieren. Offiziell hieß das Kleiderwache. An eine solche Wache – wahrscheinlich Dezember 1944 – kann ich mich noch gut erinnern, weil es auf dem Flur sehr kalt war, und ich fror. Ich wagte aber nicht, mir meinen Mantel anzuziehen - „Deutsche Jungen sind abgehärtet.“ Mit „Kohlenferien“ (Unterrichtsausfall infolge des Mangels an Kohle) endete im Januar 1945 meine Schulzeit in Meseritz.
Leider habe ich von meiner Schulzeit in Meseritz weder Fotos noch Zeugnisse, beides hätte ich nur zu gern gehabt. Die befanden sich in meiner Schultasche, die auf unserem Handwagen lag, als wir aus Meseritz vertrieben wurden. An Meiers Berg, also etwas außerhalb von Meseritz, plünderten polnische Soldaten. Meine Schultasche mit den Zeugnissen und Kinderfotos wurden uns weggenommen, für die Soldaten war das wertloses Zeug, das sie sicher bald weggeworfen hatten, für mich ein unersetzlicher ideeller Schatz.
Russenzeit in Meseritz
Unter demselben Titel habe ich meine persönliche Erinnerungen aus der Zeit vom 30. Januar bis zum 26. Juni 1945 (vgl.W: Kintzel: Die Russenzeit in Meseritz – aus der Froschperspektive eines neunjährigen Jungen. Heimatgruß – Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde des Heimatkreises Meseritz e. V. und der Heimatkreisgemeinschaft Birnbaum, Nr. 176, März 2006, S. 19-26) veröffentlicht.
Hier sollen jetzt die Ereignisse, die auch von anderen Zeitzeugen beschrieben worden waren, mit meinen persönlichen Erinnerungen verglichen, komprimiert und zu einer Verallgemeinerung geführt werden.
Bleiben oder flüchten?
Diese Frage beschäftigte die Einwohner von Meseritz gegen Ende Januar sehr intensiv. Ich kann mich noch erinnern, als meine Tante Frieda von der Winitze zu uns in die Kirchstraße kam und meinen Vater fragte: „Paul, was meinst Du, was sollen wir machen, wenn die Russen kommen?“
Mein Vater war sich uneins, er wusste es auch nicht, wie er sich verhalten sollte, neigte aber doch wohl mehr zum Verbleiben in Meseritz. Schließlich hörte ich nach längerer Zeit von ihm, er war damals 63 Jahre alt, den folgenden Satz: „Wenn es ganz schlimm kommt, ziehe ich meine Feuerwehruniform an und stell mich mit einem Gewehr in den Schützengraben.“ Man mag heute darüber denken, was man will, es offenbarte aber die damalige Gutgläubigkeit und eine gewisse Naivität, was den Krieg mit modernen Maschinenwaffen anging.
Im Hinterkopf hatten viele Meseritzer die „Bunkerlinie“, hinter der sie sich sicher glaubten, äußerten das auch in Gesprächen. Dazu kam, dass immer noch den Durchhalteparolen geglaubt wurde, auch wenn schon viele Flüchtlingstrecks durch Meseritz zogen. „Der Sonntag war sehr unruhig, laufend kamen Soldaten in unser Haus. Was sollte man tun? Das Wetter war ungünstig, 18 bis 20 Grad Kälte, Schnee. Die Straßen überfüllt mit Flüchtlingen aus dem Warthegau. Die Flucht der Einwohner war verboten. Der Gedanke war da, es könnte ja noch eine Wende kommen und auch der Gedanke, die Russen sind auch Menschen“ (Kruschel 2000) .Die Verantwortlichen, das waren die führenden NSDAP-Leute, voran der NSDAP-Kreisleiter, bagatellisierten die militärische Situation und bedrohten die Einwohner, die ohne Erlaubnis und Befehl flüchten wollten.
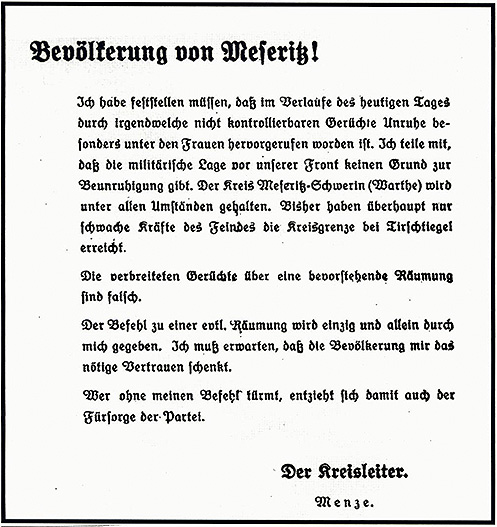 |
| Flugblatt des Kreisleiters der NSDAP vom 24. Januar 1945 (Archiv HGr) |
Am Morgen des 30. Januar, etwa gegen 5 Uhr, verließ der vorletzte Zug mit den letzten Flüchtlingen Meseritz. Heranrückende sowjetische Truppen und beginnender Beschuss lösten auf dem Bahnhof Chaos und Panik aus. Die Flüchtlinge waren gerade beim Einsteigen, als der letzte Zug mit Flüchtlingen halbleer abfahren musste. Viele konnten nicht mehr einsteigen, Familien wurden auseinandergerissen und herzzerbrechende Szenen spielten sich ab.
Zeitweilig waren die russischen Panzer vor den Zügen. Bei Trebisch wurde der Zug beschossen und musste anhalten, die Lokomotive wurde beschädigt, konnte aber stark verlangsamt die Fahrt fortsetzen. Danach sollten eigentlich nur noch die Bahnbediensteten gegen 6.30 Uhr Meseritz verlassen. Alle Lokomotiven mussten ja erst angeheizt werden, denn es dauerte ein paar Stunden, bis die Lokomotiven auf Betriebsdruck kamen. Jeder dieser Züge fuhr mit zwei Lokomotiven, um sie nicht Russen zu überlassen. „Danach ist noch der Zug mit den Bahnbediensteten gefahren. Kurz vor Abfahrt des Zuges erfolgten in der Nähe des Bahnhofs Geschoßeinschläge von Panzergeschützen oder Granatwerfern. Das Maschinengewehrfeuer war aus der Nähe deutlich vernehmbar“ (Schreiben des Landrates 1945). Vom allerletzten Zug aus Meseritz wurden unterwegs brennende Waggons abgekoppelt. Die Russen waren schon tief in den Kreis Meseritz eingedrungen, südlich und nördlich an Meseritz vorbei. Es herrschte ein unübersichtliches Durcheinander (s. Bericht von D. Kruschel). Sie fuhr am Montag, dem 29. Januar 1945 mit einem Pferdeschlitten nach Meseritz, gab dort Post auf und überwies Geld. „Herr Karl Lechelt musste Jungen zum Volkssturm nach Meseritz bringen. Etwa um 12 Uhr kam er mit dem Pferdeschlitten vorgefahren, und ich stieg mit ein. Die Eltern verpackten mich warm und verabschiedeten sich mit „bis nachher“. Es war ein Abschied für immer.
Wir kamen in der Stadt an. Herr Lechelt fuhr weiter, um die Jungen abzuliefern. Wir verabredeten, uns später im Laden Kruschel zu treffen. Herr Lechelt kam. Wir wollten ja schnell nach Hause. Durch die Kirchstraße, an der Post links, am Lustgarten vorbei, Brätzer Straße, Richtung Bauchwitz. Am Krankenhaus kamen uns deutsche Soldaten entgegen.Wir könnten nicht nach Bauchwitz, beide Brücken in Heidemühle gesprengt.Wir mussten zurück, überlegten, wie kommen wir nach Hause. Eine Möglichkeit: Schwiebuser Straße, Kalau, Schindelmühl. Als wir Kalau verlassen hatten, kamen uns Panzer entgegen. Wir waren der Meinung, es waren deutsche. Nein, es waren Russen. Nach einer Weile fuhren wir weiter. Dann spannte Herr Lechelt die Pferde aus. Wir liefen in den Wald“ (Kruschel 2000). Noch gab es für Meseritz keinen Räumungsbefehl!
„Am Montag, dem 29. Januar 1945, hörten wir, dass Korbmacher Hein, ein Geschäft für Kinderwagen, Taschen und Koffer, alles kostenlos abgibt. Ich besorgte einige Stücke. Auf dem Heimweg leuchtete im Süden der Himmel rot von einem großen Feuer. Eine größere Gruppe von Soldaten zog zur Frankfurter Chaussee. Einer fragte mich, warum wir noch nicht fort seien. Er öffnete seinen Gasmaskenbehälter und gab mir eine Handvoll Bonbons. Das war ihr Inhalt!
Zu Hause packte Mutter unsere Sachen und warf ins Feuer, was nicht in fremde Hände fallen sollte. Wir gingen angezogen ins Bett, die Lampen gaben nur noch einen rötlichen Schein. Vater richtete unsere Schlitten. Auf einen stellte er den Handwagen und bepackte ihn, falls der Schnee taute. Den Hühnern hackte er die Köpfe ab, ließ sie ausbluten und hing sie an die Rungen des Wagens. Am Morgen des 30. Januar fuhr er zum Bahnhof zur Arbeit. Er kam sofort wieder. „Die Russen stehen bei Obrawalde, ca. 3 km entfernt“ (Lisinski 2012).
Immer näher kam die russische Armee. Was machen, gehen oder bleiben? Der Kreisleiter gab noch am 28. 1. Befehl, wer Meseritz verlässt, wird erschossen, dafür hatten die Nazischweine/Bonzen ihre Autos abfahrbereit und beladen zu stehen, um jeden Augenblick abhauen zu können.
Am 29. 1. mussten wir gegen Abend noch alle aufs Finanzamt kommen, um sämtliche Akten und Fahnen sowie Bilder zu verbrennen, als Schmager blass hereinstürzte: „Die Russen stehen vor den Toren von Meseritz!“ Ich ließ alles stehen und ging nach Haus.
Tagelang hatten wir das Thema: Gehen oder Bleiben schon besprochen. Gertud konnte sich nicht trennen, obwohl auch bei uns alles gepackt war. Es war am Montag, 180 Kälte, Schnee, Eis und Sturm. Möbelwagen, Erntewagen, vollbeladene Schlitten, klein und groß, jeder mit seinem Hab und Gut – nur raus! Bei dieser Kälte wären wir, wie viele andere auf der Strecke geblieben, der letzte Zug war weg, die Bahnbrücke gesprengt, ebenso das Elektrizitätswerk, die Wasserleitung – alles von uns!“ (Morgenstern 1981).
Der Oberfeldwebel Evanius (Hielscher 1987) schildert seinen Gang am Abend des 29. Januar durch die verstörte Kreisstadt: „Auf der Hauptstraße fuhren ununterbrochenen Trecks, dazwischen einzelne versprengte Soldaten. Vor den Haustüren sahen wir Meseritzer Einwohner ihre Habe auf kleine Handwagen und Schlitten packen. Wir gingen weiter zum Bahnhof, erfuhren aber von zurückkehrenden Einwohnern, dass dort keine Züge mehr seien.“ Seit Tagen zogen Flüchtlingswagen über die Chausseen nach Frankfurt. Parteileute gingen von Haus zu Haus und versprachen, dass wir gegebenenfalls mit Lastwagen gerettet würden (vgl. Lisinski 2012)
Im Nachhinein schrieb am 7. 2. 1945 sogar der Meseritzer Landrat aus Eutin (Schleswig Holstein) an den Regierungspräsidenten in Frankfurt/ Oder: „Betr. Räumung des Kreises Meseritz. Die Rückführung der Bevölkerung des Kreises Meseritz wurde bis zum Äußersten zurückgestellt, so dass eine ordnungsmäßige Räumung nicht mehr erfolgen und von einer Rückführung der Bevölkerung im Sinne des Wortes nicht die Rede sein konnte.
In den wiederholten Kreisbefehlen, die seit Sonntag, den 21. Januar, fast täglich, zuletzt am Sonntag, dem 28. Januar, vom Kreisleiter der NSDAP herausgegeben wurden, wurde der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht, dass für die Kreise Meseritz und Schwerin-Warthe keine Gefahr bestände und eine Räumung nicht in Frage käme. Genehmigungen zur Abreise wurden lediglich den im Kreise aufhältlichen Evakuierten erteilt.
Betriebsführern, die Räumungsmaßnahmen durchführten, wurde in Kreisbefehlen die Todesstrafe angedroht. Erst im Verlaufe der Nacht vom 29. zum 30. Januar wurde der Bevölkerung das Verlassen der Kreisstadt vom Kreisleiter freigestellt.“ Ein Räumungsbefehl war nicht ergangen, eine ordnungsmäßige Bekanntgabe der Abreisemöglichkeiten an die Bevölkerung erfolgte nicht“ (Schreiben des Landrates 1945). „Den elenden Nazi-Parteilumpen haben wir alles zu verdanken. Hätte man 24 Stunden früher die Evakuierung erlaubt, dann wäre uns viel erspart geblieben“ (Dittmann 1946).
Überstürzte Flucht
Viele Meseritzer flüchteten vor den heranrückenden Russen mit Kinderschlitten, Fahrrädern, Pferdewagen oder zu Fuß.
Wir müssen los. Den ersten Schlitten zog er, den zweiten meine Schwester Cilli, 20 Jahre, und ich, 14 Jahre. Schwester Barbara, 12 Jahre, und Bruder Leo, 10 Jahre, schoben den Schlitten vom Vater. Auf der Chaussee mussten wir „Fußgänger“ den Sommerweg benutzen und kamen im mehligen Schnee nur mühsam voran. Mit uns war die Nachbarin, Frau Zeh, mit 3 oder 4 Kindern und den Großeltern. Unter Geschützdonner erreichten wir „Maiers Berg.“ Ein totes Pferd lag auf der Fahrbahn. Abgeworfener „Ballast“ füllte die Chausseegräben.
Bergab lag links „Das Auge“, ein runder See mit spärlichem Schilfrand, wie ein Auge mit Wimpern – über den gegenüber liegenden Berg fuhren Panzer. Ich fragte Vati: „Sind das unsere?“ Er schüttelte nur den Kopf. Dann entschloss er sich, von der Chaussee auf den Landweg zu wechseln, der nach „Langes Vorwerk“ führte, das dem Grafen von der Schulenberg gehörte. Dort waren bereits Flüchtlinge im leeren Haus. Deutsche Soldaten rüsteten auf dem Gutshof zum Abzug“ (Lsinski 2012).
„Am 30. Januar 1945, es war eine sehr kalte Nacht, klopfte es an unsere Fensterläden. Es waren unsere Nachbarn, die riefen: „Alle raus! Die Russen kommen!“ Wir hatten Tage vorher schon Säcke mit Sachen vollgestopft auf den Schlitten gepackt. So waren wir ein wenig auf eine Flucht vorbereitet. Als wir dann in der klirrenden Kälte bei – 18° im hohen Schnee auf der Str aße standen, kamen deutsche Soldaten und riefen uns zu, dass es zur Flucht zu spät sei, kein Zug fahre mehr und der Russe stehe vor der Stadt. Nun hörten wir deutlich den Geschützdonner der nahen Front“ (Kondezki 2007).
Der Oberfeldwebel Evanius schilderte das Abrücken der Sanitätsstaffel gegen Morgen des 30. Januar: „Ich ließ die selbstgefertigten Handschlitten auf den Korridor tragen. Es war fünf Minuten vor zwei Uhr, das Sanitätspersonal verließ mit den acht Kranken die Kaserne. Infolge der hohen Schneeverwehungen auf den Nebenstraßen zur Chaussee nach Frankfurt war das Schlittenziehen zunächst sehr anstrengend. Die dünnen Bretter schnitten tief in den Schnee ein. Alle Mann zogen oder schoben.
Auf der Chaussee fuhr Wagen hinter Wagen. Zeitweise waren sie zu dreien nebeneinander. In die Lücken schoben sich die Fußgänger. Tausende waren in dieser Nacht unterwegs. Kurz hinter den letzten Häusern von Meseritz wurde ein gelähmter Mann im Selbstfahrer von seiner Frau gezogen. Er arbeite mit beiden Händen krampfhaft, um durch den hohen Schnee zu kommen. Helfen konnten wir ihm aber nicht, denn wir führten schon Kinder an der Hand oder zogen Schlitten mit Kindern.
Eine Handvoll Kekse verteilte ich an ein Kinderpärchen, dessen Schlitten Kamerad Urban zog, damit die Mutter das Jüngste tragen konnte. Einen unserer Kranken mussten wir zwei beim Marschieren stützen. Er hatte erst die Ruhr überstanden und war vor Schwäche lang hingeschlagen. Nach einiger Zeit konnten wir einen LKW anhalten und diesen Kranken sowie die Frau mit den kleinen Kindern aufladen.
Die Straße bot rechts und links den Eindruck eines Rückzugsweges: Stahlhelme, Gasmasken, zerfahrene und verbogene Fahrräder, verlorene Kartons und herabgefallene Koffer lagen seitwärts. Auf eine Entfernung von nur wenigen Kilometer zählten wir drei verbeulte Kinderwagen. Es ging vielfach bergauf.
Aber meine Kameraden, insbesondere zwei der Kranken, die unterwegs fast Unglaubliches geleistet haben, waren erfinderisch. In fliegender Eile, mit keuchenden Lungen, wurden die Schlitten an ein die Wagen überholendes Gefährt herangezogen und dort befestigt. Musste es stoppen, dann waren die Schlitten im Handumdrehen losgemacht, die Kufen vorne angehoben, um die Richtung ändern zu können, und bald hingen die Schlitten wieder an einem anderen Gespann. Trotzdem war es eine elende Schinderei. Die Gefahr war, dass unsere beiden Schlittengruppen bei diesem Tempo auseinander gerieten. Und so musste ich immer die Verbindung aufrechterhalten. Bei Zwangsaufenthalten schob und verkeilte sich alles ineinander. Die Straße war teilweise so glatt oder es ging bergab, dass die übermüdeten Pferde zu gleiten anfingen und die Deichseln sich in die Vorderwagen eingruben. Bei der Glätte oder in den Schneeverwehungen kamen uns unsere Skistöcke sehr zugute.
Mitunter gab es minutenlange Stopps für den ganzen Treck. Pferde fielen und mussten ausgeschirrt werden. Ein Bauer rief einem anderen zu, dessen Pferd sich die Beine gebrochen hatte: ‚Da liegt dein Vermögen im Dreck! ‘ Aber Vermögen galt auf diesem Wege nichts mehr. Man sah kaum hin, als südlich der Chaussee eine russische Werferbatterie in Richtung Regenwurmlager schoss. Auch als die Granaten über die Chaussee heulten, entstand glücklicherweise keine Panik. Es war sozusagen gar kein Platz dafür vorhanden. Ein kleiner Polizeioffizier, der eine bespannte Polizei-Abteilung führte, war unermüdlich dabei, Ordnung in dieses Wagenchaos zu bringen. Im Galopp ritt er neben der Chaussee auf und ab, über die Felder, und bedrohte jeden mit Erschießen, der nicht mit seinem Gefährt Kurs halten würde; er brachte bis Tempel jeden Wagenknäuel zum Auflockern“.
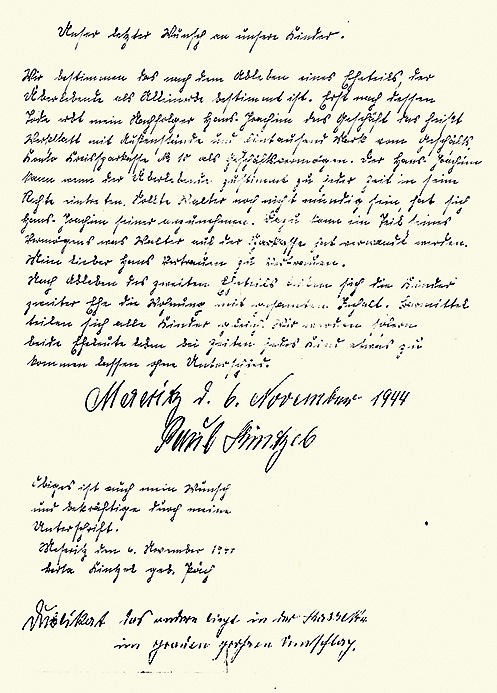 |
| Das Testament meiner Eltern vom November 1944 |
Am 30. Januar hatten meine Eltern meinen Rodelschlitten mit den notwendigsten Sachen vollgepackt und wir, Vater und Mutter Kintzel mit Sohn Walter, zogen so gegen 10 Uhr bei kaltem, etwas trübem Wetter von der Kirchstraße über den Topfmarkt bis zur Mühlstraße. Erklärtes Ziel meines Vaters, eines Soldaten aus dem I. Weltkrieg mit Erfahrungen aus dem Stellungskrieg in Frankreich, war es, bis hinter die Bunkerlinie bei Pieske zu kommen. Dann wären wir nach seiner Ansicht gesichert. So haben viele Meseritzer gedacht, waren geflohen und mussten das mit ihrem Leben bezahlen, denn viele wurden unmittelbar an der Bunkerlinie getötet.
Wir wollten gerade in die Mühlstraße einbiegen, als ein Mann, der auf dem Gericht (Hausmeister?) arbeitete und dorthin wollte, meinen Vater ansprach. „Was, Kintzel, Du willst auch türmen? Die paar Panzer mit aufgesetzter Infanterie schlagen unsere doch zurück.“ Nach einer kleinen Pause antwortete mein Vater: „Recht hast Du och, Scheiße, wir drehen um.“
Vielleicht war diese Entscheidung lebensrettend für meine Eltern und mich, denn wir wären zwischen die Fronten der Kriegsgegner geraten.
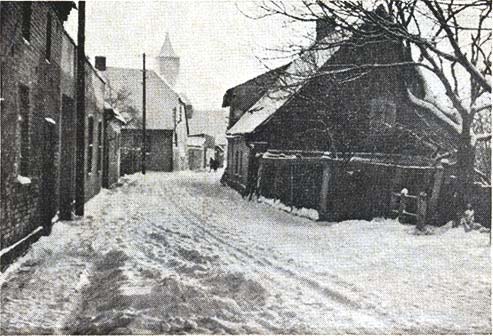 |
|
An diesem letzten Haus auf dem Topfmarkt
kehrten wir am 30. Januar 1945 um (Abb. aus Meseritzer Heimatgruß Nr. 29, Dezember 1968, S. 4 – Archiv HGr) |
Gescheiterte Flucht
„Wir blieben damals in Schermeisel über
Nacht und fuhren am nächsten Morgen weiter.
In Drossen wurde uns bei der NSV (=Nationalsozialistische
Volksfürsorge) mitgeteilt,
dass die Straße Zerbow, Kohlow usw. gesperrt
sei, wir müssten einen anderen Weg fahren,
um bei Göritz über die Oder zu kommen. Wir
fuhren also diese Richtung und kamen an dem
Tag noch bis Grunow, etwa 15 Kilometer vor
der Oder, wo wir übernachteten.
Am folgenden Tag erschien der Bürgermeister
und erklärte uns, dass wir nicht weiterfahren
dürften, da die Straße für deutsche
Panzer, die einen Gegenstoß machen, gesperrt
sei. Am Nachmittag rollten auch von
Westen her Panzer an – es waren leider nicht
deutsche, sondern russische. Damit war unser
Schicksal besiegelt und es begann eine
endlose Kette von Leiden.
Wagen und Pferde wurden uns sofort weggenommen.
Wir mussten mit der Familie des
Bauern, bei dem wir wohnten, zusammen im
Keller hausen. Nach einigen Tagen wurde
Grunow geräumt und wir kamen, unsere verbliebenen
Sachen auf zwei Schubkarren verstaut,
nach Heinersdorf zwischen
Drossen und Zielenzig, wo wir mit 65
Personen in einem Zimmer des Gutshauses
untergebracht waren. Dann
mussten wir aus Heinersdorf hinaus
und zogen nun mit unseren Karren
bei Schnee und Regen unter größten
Misshelligkeiten mit Übernachtung
in Zielenzig, Grochow und
Pieske nach Meseritz, wo wir am 5.
März ankamen.
In der Stadt lebten noch ca. 2 000
Deutsche. Sie waren zum Teil dageblieben
oder nur bis Tempel,
Schermeisel oder Zielenzig geflüchtet,
weil sie sich hinter der Bunkerlinie
des Ostwalls sicher glaubten. Militärisch
muss der Ostwall ein furchtbares Desaster gewesen
sein. Unbeschreiblich, wie es auf den
Straßen aussah – alles voller Trümmer und
Leichen. Viele ältere Menschen werden in ihrem
ganzen Leben nicht so viele Tote gesehen
haben, wie meine kleine Tochter Bärbel
mit ihren 6 Jahren. Bei Kohlow zwischen
Drossen und Reppen sind im Kampfgeschehen
besonders viele deutsche Flüchtlinge
umgekommen. Ihr endloser Treck wurde
von russischen Panzern zusammengeschossen.
In Meseritz berichtete mir ein Überlebender
von diesem Massaker“ (DITTMANN
1946).Sinnlose Opfer der HJ
Parallel zur chaotischen Flucht der Zivilbevölkerung rückte die HJ (Hitler-Jugend) nach Westen ab, um an der Bunkerlinie den russischen Vorstoß aufzuhalten.
„In den letzten
Januartagen des Jahres 1945 befanden wir
14- bis 16-jährigen Jungen uns zur militärischen
Ausbildung zu Volkssturmmännern in
Schierzig Hauland. Wir sollten die Heimat vor
den Russen verteidigen. Am Abend des 29.
Januar 1945 standen wir Wache, als eine
Gruppe von Soldaten der Wehrmacht zu uns kam. Von ihnen erfuhren wir, dass in einer
Stunde die Russen hier wären. Es wurden
sofort die Sachen gepackt und wir gingen nach
Meseritz, wo wir gegen 4.00 Uhr ankamen.
Unterwegs sahen wir schon Brände in den
Hauländereien.
In Meseritz waren alle Jungen aus den umliegenden
Dörfern zusammengezogen worden,
um im Volkssturm eingesetzt zu werden.
Um 10.00 Uhr war Appell, wo uns unsere Aufgabe
„Die Verteidigung der Heimat“ durch
Martin Fröschner (HJ-Führer) erklärt wurde.
Danach suchten einige von uns noch einmal
die Angehörigen auf, um zu sehen, inwieweit
sie schon evakuiert waren, denn die Evakuierung
für unsere Stadt und den Kreis kam viel
zu spät. Die Russen lagen inzwischen schon
in Solben.
Als wir zu unserer Einheit zurückkamen,
war diese bereits abgerückt. Sie hatte den
Weg über Georgsdorf genommen und nicht
wie geplant die Frankfurter Straße, wo wir uns
treffen sollten“ (GUTSCHE 2001).Durch die Berichte von zwei Augenzeugen (Hans Knothe und Ulrich Preuß) können wir bis in Einzelheiten rekonstruieren, was mit den Jugendlichen geschah, wie sie in unverantwortlicher Weise in den Tod getrieben wurden.
„In Meseritz hatte ich mich bei der Dienststelle
der HJ gemeldet, in der Nähe der
Obrabrücke, es waren schon die meisten
meiner Schulkameraden versammelt; sie hatten
den Nachmittag und den Abend auf einem
Bauernhof an der Ostseite von Meseritz
verbracht. An Namen kann ich mich noch erinnern:
Alfons Jost, Helmut Baldin, Dieter
Haak, Werner Pühle, Hans-Hennig Freyer,
Karl-Heinz Sawade, Ulrich Preuß; an andere
kann ich mich nicht mehr erinnern. Dann waren
noch da Martin Fröschner (Fröschner war
K-Bannführer - Bannführer im Kriegszustand,
W. K.) und ein Oberleutnant, soviel ich weiß,
Salden war der Name, dann Obergefreiter
Meier, ein Ausbilder vom Volkssturm.
Am nächsten Morgen, ungefähr drei oder
vier Uhr früh, wurden Panzerfäuste verteilt und
einige Gewehre. Ich bekam eine Pistole und
eine Panzerfaust und einige Stangen Nougat
als Verpflegung, dann sind wir in Richtung
Westen marschiert“ (KNOTHE 1973).
Zuvor hatten die Jugendlichen noch ein Dokument bekommen, das sie als regulären Teil der Deutschen Wehrmacht auswies. Man wollte damit vorbeugen, dass bei einer eventuellen Gefangennahme die Jugendlichen nicht gleich als Partisanen erschossen würden. Der Marsch war beschwerlich, es lag hoher Schnee und es war sehr kalt. Bei einem Zwischenaufenthalt in einem Bunker des Ostwalls konnten die Jugendlichen die russischen Panzerspitzen beobachten. Ein Unteroffizier der Bunkerbesatzung befahl den Jugendlichen, dass sie zur Verteidigung in die Bunker einrücken sollten. Der Oberleutnant machte ihm aber klar, dass er mit dem höheren Dienstgrad zu befehlen habe und die Jugendlichen nicht in den Bunker einrücken, sondern weitermarschieren werden (mdl. U. PREUSS).
Russische Jagdflugzeuge hatten die marschierende Kolonne ausgemacht und griffen sie im Tiefflug an, die Jugendlichen mussten mehrmals im Chausseegraben volle Deckung suchen. Bei Schermeisel erfuhren sie, dass feindliche Panzer in der Nähe seien. Deshalb bog die Marschkolonne von der Hauptstraße ab und wich auf Nebenstraßen und Feldwege aus, die tief verschneit waren. Das erschwerte das Marschieren.
Am Abend organisierte der Obergefreite Meier Pferd und Wagen, die Jugendlichen konnten nun wenigstens ihre Tornister auf den Wagen legen, was ihnen das Marschieren erleichterte. Dann wurden einige Melder vorausgeschickt, um im nächsten Ort, das war Gleißen, Quartier zu suchen.
Dazu schreibt H. STÜRMER (1999):
„Ich bin eine geb. Stürmer, und wir wohnten
im ersten Gehöft vom Dorf. Um 20 Uhr
klopfte ein Vorgesetzter (oder waren es zwei?)
von ihnen an und erkundigte sich, wo der Bürgermeister
wohnt. Auf unsere Frage, worum
es sich handele, sagte er, man wollte
Hitlerjungen sicher von der Front zurückzubringen.“Sie fanden Quartier an zwei Stellen, in einer Gastwirtschaft und in einem ehemaligen Gefangenenlager von französischen Soldaten (Stacheldrahteinzäunung des Gebäudes, vergitterte Fenster), um in Doppelstockbetten auf Strohsäcken zu übernachten. Mit ungefähr vierzig anderen Jungen waren H. Knothe und U. Preuß im ehemaligen Gefangenenlager.
Alle waren vollkommen erschöpft, legten sich auf die Strohsäcke und deckten sich mit ihren Mänteln zu, weil sie keine Decken hatten. Vor Erschöpfung schliefen die Jugendlichen schnell ein. Vor dem einzigen Eingang zu diesem Saal waren Posten aufgestellt worden, die mitten in der Nacht näherkommende Soldaten hörten und Russen vermuteten. Sie gingen in den Schlafsaal, weckten Martin Fröschner und sagten ihm das.
Fröschner sagte aber: „Lasst die Jungen schlafen, sie sind erschöpft, das sind wahrscheinlich nur Gerüchte.“ Er hat das nicht ernst genommen. Kurze Zeit später „flog die Tür auf und ein mit einer MPi bewaffneter Russe stand davor und schrie „Ruki werch!“ (Hände hoch!) Da uns mitgeteilt worden war, dass an diesem Abschnitt der Front keine lebenden Gefangenen gemacht werden, begann sofort eine wilde Schießerei.
Von draußen flogen Handgranaten herein, die unter meinen Kameraden ein fürchterliches Blutbad anrichteten. Das im Saal ohnehin spärliche Licht ging aus, Teile der Saaldecke stürzten herab und begruben etliche Kameraden unter sich. Da es aus dem Saal nur einen einzigen Ausgang gab, war es für die Russen einfach, mit Maschinenwaffen unseren „Hurra- Ausbruch“ blutig zu gestalten“(PREUSS 2005).
KNOTHE (1973) beschrieb die Situation so:
„Das nächste was passierte, waren einige
Schüsse in unseren Raum, von denen Holzsplitter
und Steinsplitter um den Kopf flogen.
Im ersten Augenblick dachte ich, ich wäre
verwundet, aber dann konnte ich schnell feststellen,
dass es nur Holzsplitter waren. Dann
fingen einige Jungen an zu jammern, die getroffen
waren; und es war niemand da, der
irgendwie Kommandos gab oder irgendwie
sagte, was wir tun sollten. Wir waren mitten
im Schlaf aufgewacht und wussten nicht, was
eigentlich los war, alles sah ziemlich hoffnungslos
und verzweifelt aus. Einer von den
Jungen rief: „Mama, Mama, komm hilf mir!“
Einer sagte: „Wir müssen uns ergeben.“
Andere legten Stühle auf das Bett und verschanzten
sich mit ihren Karabinern hinter den
Stühlen, dann hörte das Schießen durch die
Tür auf und einige von den Jungen versuchten,
durch die Tür auszubrechen. Als sie die
Tür aufmachten, wurden sie sofort mit
Maschinengewehrfeuer empfangen und alle
rannten wieder zurück in den Saal. Dann war
wieder Ruhe, die Tür war offen, draußen war
Mondschein, kein Schießen mehr, wir lagen
und warteten, was passieren würde. Das
nächste, was passierte, die Russen hatten
eine geballte Ladung oder irgendeinen
Explosionskörper aufs Dach geworfen und mit
lautem Krachen kam die Zimmerdecke runter
und begrub ungefähr die Hälfte der Jungen,
der Rest versuchte wieder auszubrechen. Mit
dem gleichen Ergebnis, sie wurden von Maschinengewehr
empfangen, einige rannten
raus, ich war auch dabei und dann konnte ich
sehen, wie sich alle hinwarfen, einige sprangen
wieder auf, einige blieben liegen.
Es war außer mir noch ein anderer Junge,
der den Zaun auf der anderen Seite vom Hof
erreichte. Wir sind dann unterm Stacheldraht
durchgekrochen, und als wir dann über das
freie Feld dem Wald zu rannten, schossen die
Russen wieder mit Maschinengewehren nach
uns. Wir warfen uns wieder einige Male hin,
dann hörte das Schießen auf. Aufspringen,
weiterlaufen, und dann konnten wir wieder die
Einschläge von dem Maschinengewehr im
Schnee sehen, ziemlich dicht in der Nähe.
Aber wir hatten Glück und erreichten den
Wald, dann hörte das Schießen auf.
Es war ein Hochwald und als wir uns umsahen,
kämmten von allen Seiten russische
Soldaten den Wald durch. Wir sind dann weiter
in den Wald hineingelaufen und in eine
Kiefernschonung gekommen, dann durch diese
durchgekrochen. Als wir auf der anderen
Seite herauskamen, konnten wir niemanden
mehr sehen. Wir sind dann weiter in Richtung
Westen gelaufen, bis wir den nächsten Ort
erreichten. Verschiedene Male haben wir noch
russische Soldaten gesehen und haben uns
versteckt.
Den anderen Jungen mit dem Oberleutnant
Salde, die in der Gastwirtschaft übernachtet hatten, war es ähnlich ergangen, nur Oberleutnant
Salden als erfahrener Soldat hat nicht
gesagt, dass die Jungen schlafen sollten. Er
hat das ernst genommen als die Wache kam,
hat alle sofort aufstehen lassen. Sie haben
das Gebäude verlassen und ein Haupttrupp
ist abmarschiert in Richtung Westen. Die
Nachhut hat sich mit den Russen rumgeschossen
und dabei ist Hans-Henning
Freyer ums Leben gekommen. Ich glaube, das
war der einzige, der von der anderen Gruppe
gefallen ist.
Wir haben uns dann alle später in
dem Ort, den ich eben erwähnt habe, den
Namen weiß ich nicht mehr, getroffen und sind
dann weitermarschiert in Richtung Westen
und gegen Abend mit einem Lastwagen nach
Frankfurt an der Oder gefahren worden.
Alfons Jost war noch mit einigen anderen
Jungen zurück, als wir ausgebrochen sind und
versuchten zur anderen Seite des Zaunes zu
kommen, wobei die meisten von den Jungen
erschossen wurden. Unter den Verwundeten
war auch Martin Fröschner, dem das Blut aus
dem Mund lief, er hatte wahrscheinlich einen
Lungenschuss, und Werner Pühle, dem das
Bein abgeschossen war, rief immer: ‚Kameraden,
lasst mich nicht liegen, nehmt mich mit.‘
Alfons und ein anderer Junge nahmen dann
eine Panzerfaust und schossen sie in Richtung
der Russen ab, daraufhin haben sich die
Russen zurückgezogen oder zumindest das
Feuer eingestellt und die restlichen vier oder
fünf Jungen konnten dann das Gefangenenlager
verlassen, ohne weiter beschossen zu
werden.“Ulrich Preuß kam zunächst noch unverletzt aus dem Saal und lag dann in Deckung hinter einem Wall von leblosen Kameraden.
„Als ich
auf der Suche nach einem Ausweg meinen
Kopf hob, traf mich ein Geschoss aus einer
MPi; wie man mir später sagte, seitlich kommend
in das rechte Auge und zerfetzte es total,
ein weiteres Geschoß kratzte meinen
Oberkörper unter dem rechten Arm, gottlob
nur ein ungefährlicher kleiner Streifschuss.
Später im Lazarett sagte man mir, dass bei
einer Abweichung von 1 mm die MPi-Salve
meine beiden Augen zerstört hätte. Wie ich
durch den Stacheldraht des ehemaligen Gefangenenlagers
hindurchgekommen bin, weiß
ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass mich
außerhalb des Zaunes zwei Kameraden in
Empfang genommen haben und wir dann
gemeinsam die Flucht ergriffen“. (PREUSS
2005).Ulrich Preuß, sein Freund und Klassenkamerad vom Gymnasium, Wolfgang Heidtke, und ein weiterer Kamerad, der einen Oberarmschuss hatte, flüchteten gemeinsam:
„Bei unserer
Flucht durch den tiefen Schnee wurden
wir von den Russen beschossen. Man sah die
Einschläge neben und hinter uns deutlich im
Schnee. Wir bildeten offensichtlich gute, lebendige
Zielscheiben, denn wir trugen ja unsere
schwarzen Winteruniformen. Da das Fliehen
im hohen Schnee sehr beschwerlich war,
verließen mich wegen meiner schweren Verletzung
schon sehr bald die Kräfte. Ich bat
deshalb meine Kameraden, mich unter einen
Busch am Wegrand zu setzen, um ...
Die aber
organisierten stattdessen einen Rodelschlitten,
setzten mich darauf und zogen mich mit
sich, obwohl sie auch am Ende ihrer Kräfte
waren. Sie brachten mich in ein Dorf, dessen
Namen ich nicht mehr weiß, zu einer Diakoniestation,
wo ich provisorisch verbunden wurde.
Dann verabschiedeten sich meine beiden
Lebensretter von mir.“ (PREUSS 2005).Die aufopferungsvolle Kameradschaft und Hilfe von Wolfgang Heidtke und von dem verletzten, namentlich nicht bekannten Jungen retteten Ulrich Preuß das Leben. Nachsatz von W. Kintzel: Wolfgang Heidtke und Ulrich Preuß sind der Meinung, dass etwa 40 Hitler-Jungen in dem Raum des Gefangenenlagers gewesen sind. Es überlebten aus diesem Raum nachweislich: Helmut Baldin, Dieter Haak, Wolfgang Heidtke, Alfons Jost, Hans Knothe, Ulrich Preuß, namentlich nicht bekannter Junge, der mit Hans Knothe flüchtete und ein namentlich nicht bekannter Junge, der mit Ulrich Preuß und Wolfgang Heidtke flüchtete.
Dieter Haak war der einzige, der den Weg zurück nach Meseritz einschlug, dort wohnte er bis zur Vertreibung bei der Familie des Schuhmachers Kaulich. Da Ulrich Preuß der Bruder meines Spielkameraden Rüdiger Preuß war und ich ihn aus der Kirchstraße 16 sehr gut kannte, fragte ich wiederholt Dieter Haak nach dem Verbleib von Ulli. Er gab mir immer zur Antwort, dass Ulli gefallen sei, was mich sehr traurig stimmte. Zum Glück war es anders!
Hildegard STÜRMER (1999), die am Dorfrand von Gleißen wohnte, berichtete, dass am selben Abend, an dem die Hitler-Jungen bei ihnen geklopft hatten, um 22 Uhr ihr Nachbar klopfte, der vom Volkssturm abgehauen war und seine Frau suchte, die bei der Familie Stürmer war. Als es dann um Mitternacht wieder klopfte, waren es die Russen, die auf der gleichen Straße gekommen waren wie zuvor die Hitler-Jungen. Sie schreibt weiter:
„Wir hörten dann eine wilde Schießerei –
und danach kamen die Tage des Grauens. Am
1. Februar verließen wir unseren Hof und gingen
zu meinem Onkel. Als wir zu meinem
Onkel gingen, mussten wir über Leichen steigen,
die auf der Straße lagen. Man hatte ihnen,
weil sie noch halbe Kinder waren, tot,
einen Nuckel in den Mund gesteckt. Von Verwundeten
hat man nichts erfahren. Wann die
Toten beerdigt wurden, kann ich nicht sagen.
Es war Schnee und starker Frost. Erst als das
Wetter milder wurde, gaben die Russen den
Befehl dazu. Mein Onkel hat mitbeerdigt.
Wir hatten ja noch Vieh zu Hause stehen
und einmal am Tag gingen wir füttern und
melken. Da sah man die Wölbung des Massengrabes
im Vorübergehen. Viel Gedanken
hat man sich in dieser Zeit nicht gemacht,
denn man hatte ja selbst mit dem Leben fast
abgeschlossen. Zwei von den Jungen, die die
Nacht überlebt hatten, blieben noch ein paar
Tage in Gleißen und haben bei meinen Verwandten
mitgegessen. Sie hatten aber Angst,
man könnte sie finden und waren plötzlich
verschwunden.“Volkssturm Das 1. Aufgebot des Meseritzer Volkssturmes rückte in der Nacht vom 29. zum 30. Januar in letzter Stunde ab. Am 2. Februar geriet es hinter Zielenzig in ein Gefecht, da die Russen bereits die Straße gesperrt hatten. Truppweise versuchten die Männer, sich durchzuschlagen. Das gelang aber nur wenigen, unter anderem dem Arzt Dr. Gaethgens, der trotz seines hohen Alters die Eisgang treibende Oder durchschwamm. Andere entledigten sich ihrer Uniformteile und schlugen sich mühselig nach Hause durch. Das 2. Aufgebot des Meseritzer Volkssturmes fiel bei Tempel den Russen in die Hände, die die 150 Männer durch Genickschuss töteten.
Die Leichen mussten längere Zeit liegen bleiben, womöglich, um die zurückgebliebene Bevölkerung einzuschüchtern. Noch im Mai sah ein Mann aus Schwiebus die Toten liegen und vermochte einige zu erkennen. Dann fanden sie ihre Ruhe in einem Massengrab nahe der nach Zielenzig führenden Straße.
Tragisch war auch das Ende einer anderen Volkssturmeinheit bei Kurzig:
„Hier in den
Waldungen waren im Sommer 1944 bis Januar
1945 ganz moderne Stellungen gebaut
worden, Hunderte von Berliner Arbeitern hatten
unter Leitung von Pionier-Kommandos
gearbeitet. Die Bauern hatten die Gespanndienste
geleistet. Durchweg lagerten damals
auf unseren Scheunentennen 60 bis 100
Mann.
Im letzten Januardrittel 1945 wurden diese
Stellungen von dem sogenannten Volkssturm,
Arbeitern und Bauern aus der Gegend von
Landsberg a. d. Warthe, besetzt. Sie waren
größtenteils in Zivil und ohne Waffen. Sie sind
von den Russen erschlagen worden, sie lagen
haufenweise vor den Bunkern. Der Russe
trieb später die 10- bis 14jährigen Jungen
zusammen, sie haben die Toten unter Aufsicht
der Russen beerdigt“Bäckermeister Koschitzki, ein Mitglied des Meseritzer Volkssturms, berichtete über seine Erlebnisse auf einem Irrweg:
„Mein Marsch
ging Richtung Pieske, wurde durch russische
Panzer, von Kainscht kommend, in den Wald
gedrängt, da die Straße von den Panzern
beschossen wurde. Durch Schnee, der oft bis
zu den Knien ging, erreichte ich Kurzigmühle,
wo ich einen Tag im Bunker bleiben musste.
Hier beobachtete ich, wie die russischen Panzer
im Gelände hin und her fuhren. Um 19
Uhr am nächsten Tag wurde Räumungsbefehl
gegeben, so mussten wir uns Schlitten besorgen,
um verwundete Kameraden mitzubekommen. Nun ging es in Richtung Schermeisel
weiter. Wir hatten aber noch nicht Grochow
erreicht, als der Befehl kam, die Bunker verstärkt
zu besetzen. Unterwegs traf ich Trogsch,
Sawade und noch einige andere Kameraden,
konnte aber nicht so schnell mitlaufen und sah
sie dann nicht mehr, als ich Pieske erreichte.
Dort besuchte ich noch Familie Sauer, die mir
zu essen gab. Plötzlich fielen Schüsse und
ich eilte durch den Garten fort, wo ich dann
mit Mybes zusammentraf.
Am Dorfausgang nach Tempel wurde ich
am linken Knie verwundet, ließ mich verbinden
und lief mit noch einem Verwundeten, so
gut es ging, unter ständiger Beschießung der
Straße, nach Tempel. Hier nahm uns ein Wagen
mit nach Grochow, wo ich Kantor Paetzold
auf dem Gutshof stehen sah. Mit einem Lastwagen
ging es sofort weiter nach Zielenzig.
Wir mussten dann wieder zu Fuß unseren
Weg fortsetzen und trafen im Wald bei Langenfeld
die Volksstürme Meseritz und Obergörzig.
Meiner Verwundung wegen wurde ich Fahrer
eines Gepäckwagens. Vor Drossen machten
wir mit den Fahrzeugen Halt, von wo aus die
meisten Kameraden die Oder zu erreichen
suchten. Die restlichen Nachtstunden verbrachten
wir in einem an der Straße liegenden
Haus. Gegen Morgen sahen wir, wie plötzlich
russische Panzern an unserem Fenster
vorbeirasselten, bis schließlich einige stehen
blieben und die Russen mit der MPi in der
Hand uns einen Besuch abstatteten, um unsere
Uhren abzuholen.
Nach dieser Erleichterung
traten wir in einzelnen Gruppen den
Heimweg an. Bei einbrechender Dunkelheit
erreichten wir Zielenzig, wo wir auf einem
Gehöft übernachteten“ (KOSCHITZKI 1970).Über Schermeisel, Grochow, Pieske gelangte Herr Koschitzki nach Meseritz.
Besetzung von Meseritz durch die Russen – Kampfhandlungen
Der HJ-Angehörige Günther Gutsche, der – Glück im Unglück – den Abmarsch seiner HJ-Einheit verpasst hatte, stellte fest, dass am 30. Januar so gegen Mittag Spähtrupps der Russen strategisch wichtige Schwerpunkte der Stadt – u. a. die Brücken über die Obra und Packlitz – bereits besetzt hatten. Am späten Vormittag stand auf der Straßenkreuzung an „Haugs Ecke“ (in unserer Familie auch „Kruschels Ecke“ genannt) ein deutscher Soldat, das Gewehr über die Patronentasche gelegt und rief: „Straße räumen, die Brücke wird gesprengt!“ Die Obrabrücke wurde nicht gesprengt, aber die Fernsprechzentrale in der Post.
Kurz danach haben die Russen Meseritz gestürmt. Es war so gegen 14.30 Uhr, als sie die Kasernen und Siedlungen besetzten.
„Am Nachmittag des 30. Januar kamen die
ersten Russen in das Haus Kirchstr. 16. Mein
Vater hatte hinterher auf die Uhr gesehen und
kommentiert „Also waren um halb vier die ersten
Russen in unserem Haus“. Es waren vier
Rotarmisten, den Karabiner mit dem Lauf
nach unten über die rechte Schulter gehängt,
wollten sie wissen, ob wir Waffen hätten. Mein
Vater hielt ihnen seine gebogene Tabakspfeife
hin und meinte, dass sei seine Waffe. Sie
bekamen von verschiedenen Personen Zigaretten
und verließen friedlich die Wohnung.
Hinterher räsonierte mein Vater mit der Frau
aus einem Dorf bei Meseritz, weil sie nach
seinem Dafürhalten zu freizügig mit den Zigaretten
gewesen sei, denn es kämen bestimmt
noch mehr Russen“ (KINTZEL 2006
a).Am Westrand der Stadt hatten die Russen Geschütze und Stalinorgeln aufgestellt, die in Richtung Kainscht, Jordan, Paradies, also auf die Bunkerlinie feuerten.
„Plötzlich begann
eine wilde Schießerei und wir mussten wieder
in den Keller. Eine größere Einheit der SS aus
Müllrose wollte Meseritz zurückerobern. Sie
kamen bis in die Nähe der Kasernen, wurden
aber wieder zurückgeschlagen“ (GUTSCHE
2001).Aus derselben Straße berichtete G. GONDETZKI (2007):
„Einige Stunden später brannte unsere
schöne Stadt Meseritz und die Panzer rollten
auf uns zu. Wir versteckten uns in den Kellern.
Vor unseren Häusern wurden Geschütze
aufgestellt, welche zur Bunkerlinie (Ostwall)
feuerten. Es war ein Kugelhagel und der erste
Sturm der Russen war in derselben Nacht
schnell in Richtung Frankfurt/ Oder weiter gezogen.“ Auch wenn die Stadt nicht systematisch von der deutschen Wehrmacht verteidigt wurde, gab es doch einzelne Gefechte mit zurückweichenden deutschen Soldaten.
„Aber auch der Kampf kostete hunderte von
Opfern. Die Mehrzahl, in der Hauptsache SS,
liegt in zwei Massengräbern hinter dem Gut
König und im Garten von Ackerbürger Wolff
nahe dem Landgericht. Überall sonst verstreut
einzelne Kameraden, die ich selbst noch verscharren
helfen musste“ (KLOSE o. J.).Martin Meißner, der sich auf LEO LISINSKI beruft, berichtete mir, dass die ältere Schwester von L. Lisinski beim Vergraben der getöteten Soldaten helfen musste. Die ältere Schwester von Gertrud Gondezki sollte auch mithelfen, ist aber in Erinnerung an ihre erschossenen Eltern schreiend davongelaufen.
Die vereinzelten Kämpfe zogen sich bis Anfang Februar hin, hatten ihren Höhepunkt aber am 31. Januar bzw. in der Nacht vom 30. zum 31. Januar.
„Es begann die erste Nacht unter sowjetischer
Besatzung. Meine Mutter und ich schliefen
auf einer Couch, mein Vater saß angezogen
im Sessel. Von der Straße hörte man das
Schießen aus automatischen Waffen, offenbar
aus Maschinenpistolen, dazwischen
Gewehrschüsse. So ging das mehrere Nächte.
Auf der Kirchstraße lagen tote deutsche
und sowjetische Soldaten,
teilweise von Militärfahrzeugen
überfahren. An
einem Vormittag Anfang Februar
kam eine versprengte
Gruppe deutscher Soldaten,
ca. 30 Soldaten, aus der
Richtung Landratsamt und
bewegte sich auf „Kruschels
Ecke“ zu. Teilweise hatten
die Soldaten trockenes Brot
in der Hand und bissen
davon ab.
In der Hinterstraße am Toreingang
zum ehemaligen
Hotel „Schwarzer Adler“ hatten
sich Rotarmisten verschanzt
und schossen.
Ich
fand das total aufregend,
konnte ich doch hinter den Gardinen stehend
beobachten, wie die deutschen Soldaten, die
in auseinander gezogener Linie die Hinterstraße
überquerten, erst einmal von der Hausecke
des Hotels „Spielhagen“ einen Schuss
in Richtung Toreinfahrt abgaben, um dann im
schnellen Lauf die Straße zu überqueren.
Wenige taten das nicht, was mich verwunderte.
Ich wollte aus kindlicher Neugierde die
Gardinen wegziehen, wurde aber sehr harsch
und barsch von meinem Vater zurückgerissen
„Müssen denn die Russen wissen, dass hier
noch Deutsche wohnen?“
Gleichzeitig hörte
ich ihn auch mit folgenden Worten, so halb an
die Soldaten gewandt, vor sich hinsprechend:
„Nun kämpft mal schön, nachher könnt ihr von
uns etwas zu essen und Zigaretten bekommen.“
Es wurde später erzählt, dass sich ein
Trupp deutscher Soldaten den Russen etwa
in Höhe der Mühlstraße ergeben hätte.
Die entwaffneten Soldaten seien dann von
den Russen totgeschlagen und auf dem Dreieck
zwischen Gefängnis, Gehöft des Ackerbürgers
Wolff und Packlitz verscharrt worden.
Angeblich hat ein Mann aus dem Bodenfenster
eines Hauses auf dem Topfmarkt das Geschehen
beobachtet. Dort gab es tatsächlich
ein Massengrab, waren es diese deutschen
Soldaten?“ (KINTZEL 2006 a) |
|
Meseritzer Topfmarkt und katholische Kirche
(Archiv HGr) |
Leiden der Zivilbevölkerung
Die Familie Lisinski, die aus Meseritz geflohen war, übernachtete vom 30. zum 31. Januar in einem Keller eines leerstehenden Hauses bei „Langes Vorwerk“.
„Wir ließen die Schlitten draußen stehen und
gingen in den Keller, weil der Beschuss immer stärker
wurde. Gegen Abend wurde es ruhiger. Die
Frauen machten etwas zu essen. In einem Raum
war Stroh mit einem Teppich bedeckt. Eng zusammengerollt
verbrachten wir Kinder dort die Nacht.
Am nächsten Tag, dem 31. Januar, war alles ruhig.
Die Soldaten waren fort. Sie hatten viel Proviant
zurückgelassen und wir Kinder freuten uns
natürlich über die Vitamin-Bonbons. Gegen Mittag
sahen wir auf der Pflaumenallee, die von der
Chaussee direkt auf das Haus führte, die ersten
Panjewagen. Ihr Weg ging im spitzen Winkel von
der Chaussee ab. Man sieht das Haus erst, wenn
man zurückschaut. Von Pieske kommend, war es
der Weg zum Vorwerk. Wir wurden im vorderen
Zimmer alle zusammengescheucht.
Da wir ja unsere besten Sachen anhatten, waren
wir für sie „Kapitalisten“. Sie hielten uns für
die Gutsbesitzer und wollten, dass wir die verschlossenen
Schränke öffnen sollten. Wir konnten
es natürlich nicht. Da schlugen sie im hinteren
Zimmer die Türen ein. Es war das „Herrenzimmer“
und die Schränke voller Gewehre!! Da wurden wir
wieder ins vordere Zimmer geschickt und verhört.
Meine Eltern konnten Polnisch und antworteten
auf die Fragen, so gut es ging. Der Russe zeigte
auf die Flüchtlingsfrau: „Wo ist der Mann? In
Russland und erschießt Russen?“ Meine Mutter
sagte: „Sie ist nicht verheiratet. „Und das Kind da?“
„Sie ist eine Hure.“Meine Schwester (Cilli) haben
sie später nach oben geschleppt, wo Schlafräume
waren. Die Soldaten waren ins Zimmer gekommen
mit Reitpeitschen und Pistolen, verriegelten
die Tür, die Innenladen der Fenster wurden bis
auf einen Flügel geschlossen. Ich dachte nur:
Besser gleich erschießen als ausgepeitscht zu
werden. Da rappelte es an der Tür, die Soldaten
öffneten. Zwei Offiziere kamen herein, sahen uns
8 Kinder und scheuchten uns mit einer Handbewegung
in die Dunkelheit. Wir konnten gehen.
Wohin? Wir wollten zurück auf die Chaussee. Auf
der Chaussee fuhren Panjewagen Richtung Frankfurt. Cilli wurde fortgerissen und auf dem Wagen
vergewaltigt. Mehrere Tage war sie Opfer von russischen
Soldaten. Wir mussten ohne sie abziehen,
zurück in Richtung Meseritz und sahen sie
erst drei Tage später wieder. Es waren Höllentage
für sie, unzählige Male vergewaltigt, weitergegeben
an nachfolgende Einheiten, unzählige Male.
Sie sagte, es sei schlimm, sie hatte schreckliche
Schmerzen im Rücken, wenn sie so aufs Bett
geworfen wurde. Meine Mutter entdeckte einen
Punkt neben der Wirbelsäule. Als sie ihn berührte,
schrie Cilli auf. Als Mutter von acht Kindern war
sie in Erster Hilfe geübt. Ich weiß nicht mehr wie,
aber es war eine Nähnadel, die sich da reingedrückt
hatte.
Da in der Stadt noch gekämpft wurde und Häuser
brannten, zogen wir unseren Schlitten vor die
letzte Haustür und richteten uns irgendwie für die
Nacht ein. Wir waren 16 Personen in zwei Räumen.
Die Nacht war sehr unruhig, immer wieder
kamen Russen“ (LISINSKI 2012).
Die zweite Welle der eindringenden Russen verhielt sich viel brutaler.
„Etwa zwei Stunden später
kamen im Dunklen zwei Russen, die sich viel aggressiver
zeigten. Das Dienstmädchen von der
Uhrmacherin Handke wollte aus dem Fenster
springen, Frau Handke hielt sie nur mit Mühe zurück.
Zu diesem Zeitpunkt verstand ich das noch
nicht, später, als ich dann die Worte „plündern“
und „vergewaltigen“, die ich bisher nicht kannte,
verstand, wurden mir so manche Zusammenhänge
klar. Die Erwachsenen mussten die Hände hoch
heben und die Jackentaschen wurden gefilzt.
Meinem Opa rissen die Russen Papiere (Ausweis
und Geldscheine) aus den Taschen und warfen
sie auf den Boden. Ich hob sie danach auf. Als
mein Opa, in der Meinung, nun hätten sie ja alles
aus den Taschen gefunden und rausgerissen, die
Hände senkte, richtete sofort ein Russe seine Pistole
auf meinen Opa. Hedwig, eine Polin, die bei
dem Friseur Fritz Schachner im Haushalt beschäftigt
war, flehte ihn an, doch nicht auf den „stari
ded“ (alten Opa) zu schießen. Es hatte Erfolg. Es
war ein Segen, dass Hedwig bei der Familie
Schechner geblieben war, konnte sie doch dolmetschen
und – gelinde ausgedrückt – manches
Missverständnis ausräumen.“ (KINTZEL 2006 a).Ähnliches berichtete auch GUTSCHE (2001):
„Die Nachhut, die folgte, war der „Höhepunkt“,
denn Stalin und Ilja Ehrenburg hatten den Befehl
ausgegeben, dass die Russen, wenn sie die deutschen
Grenzen überschreiten – in den ersten 24
Stunden – machen können, was sie wollen. Das
bekamen die Mädchen und Frauen zu spüren. Sie
wurden vergewaltigt und einige danach gleich erschossen
oder nahmen sich selbst das Leben.“
Besonders hatten die Mädchen und Frauen zu
leiden, das Alter der Vergewaltigten spielte
überhaupt keine Rolle, Schulmädchen und Greisinnen
mussten das gleichermaßen erdulden. „Mit
Vergewaltigungen machten sie vor keinem Alter
halt. Ich war klein, nur 1,40 m, setzte mich zu den
anderen Kindern und spielte. Das half und ich bin
den Vergewaltigungen knapp entgangen. Ich habe
auch eine Nacht mit angezogenen Knien im Drahtkinderbett
verbracht.
Die Angst setzte ein, wenn wieder Russen in
die Wohnung kamen. Wie ich hörte, wurden auch
Jungen missbraucht. Einmal stand ein Exhibitionist
längere Zeit an der Scheune. Minimal aufgeklärt,
ein Schock für mich! Am schlimmsten traf
es die drei Schwestern vom ersten Eingang. Sie
waren ungefähr 13, 15 und 17 Jahre alt. Die Russen
müssen ihr ‚Wissen um die Drei‘ weitergegeben
haben. Sie hatten ein Haus auf der rechten
Seite der Wilhelmstraße, gegenüber dem ersten
Gebäude der Kaserne, als eine Art Sex-Schuppen
eingerichtet. Die drei Mädchen wurden mit
einem Schlitten geholt und gebracht. Zwischen
Bringen und Holen verging oftmals nur wenige Zeit.
Es muss für sie die Hölle gewesen sein. Wie sind
sie wohl damit fertiggeworden? Wie konnten sie
damit weiterleben?“ (LISINSKI 2012)Auszug aus dem Bericht des Uhrmachers Klose
Rücksichtslos machten die Russen von ihren Schusswaffen Gebrauch. Alle Zeitzeugen aus der damaligen Zeit in Meseritz berichten von willkürlichen Erschießungen. Die grausige Liste der Opfer ist lang, die nachfolgende Aufzählung ist sehr unvollständig, zeigt aber die Rücksichtslosigkeit. Einige der Getöteten wurden erst gefunden, als die deutschen Frauen von der russischen Besatzung gezwungen wurden, die leerstehenden Wohnungen aufzuräumen.
Ich weiß nicht, ob eine vollständige Übersicht der Meseritzer existiert, die von den Russen erschossen wurden; ich gebe hier nur die Namen mit Originalangaben aus den Zeitzeugenberichten wieder:
– Frau Bäckermeister Sachs sen.
– Frau Mechaniker Schiller, Wiedener Straße
– Frau Barbier Seiler
– Frau Bretthauer wurde erschossen, weil man in ihrem Haus SS-Uniformstücke ihrer Söhne fand Oberschwester Lydia und 5 weitere Schwestern wurden im Keller des Auguste-Viktoria-Krankenhauses erschossen.
Ebenso erschossen lag im Haus Frau Urbach Ackerbürger Wolff, Mühlenstraße,
der alte Nagel (Holzwollefabrik) wurde bei den Kasernen erschossen,
Chauffeur Lukas,
Tierarzt Dr. Schmoldt wurde in seiner Wohnung in der Kerststraße erschossen.
Schornsteinfegermeister Jaenicke wurde in seiner Villa erschossen.
30 Personen im Grenzmarkhaus, darunter Fischer Hausmann, Bäcker Berndes und sein Sohn Den Schornsteinfeger von Kainscht, den großen Villenbesitzer, haben Gertrud und ich erschossen in seiner Wohnung aufgefunden.
Wilhelm Schreiber war so leichtsinnig, eine Pistole mit auf die Flucht zu nehmen. Er wurde bei Langes Vorwerk gestellt, untersucht und erschossen.
In den Berichten werden auch Namen von Personen genannt, die in Meseritz bekannt waren (Landwirte, Förster, Gutsbesitzer), aber in den umliegenden Dörfern wohnten. z. B. fünf Personen der Familie Stallmann (Tempel) wurden erschossen, weil sich der Vater schützend vor seine 19jährige Tochter stellte.
Frau von Gestorf und Schwester Julchen, Bauchwitz nahmen Gift, ebenso Fräulein Jüttner. Herr Seiler und die Geschwister Knote erhängten sich.
Frau v. Gersdorff (Bauchwitz) nahm sich zusammen mit Frau v. Funck das Leben.
Fuhrwerksbesitzer Nitschke und Frau haben sich auch das Leben genommen.
Herr Knothe mit Schwester, er war früher auf dem Gericht, hat sich in der Wohnung von Schmiedemeister G. Behnisch erhängt, Gertrud erkannte ihn seinerzeit beim Wohnungsaufräumen.
„Das Schlimmste kam am nächsten Tag, dem
31. Januar 1945. Die zweite Welle der Russen eroberte
Meseritz und das große Leiden begann.
Am 31. Januar, meinem Geburtstag, ich wurde
13 Jahre alt. Am frühen Morgen dieses Tages
herrschte eine unheimliche Stille, bis eine wilde
Schießerei, Panzerrollen und Geschrei begann.
Meine Eltern, meine Schwester, damals 18 Jahre
alt, und ich waren in unserem Haus, um noch einige
Sachen einzupacken. Meine Eltern schickten
uns rasch zu Familie Gutsche, unsere Nachbarn,
und ließen sagen, dass sie gleich nachkämen.
In unserer Straße waren nur noch wir und
die Familie Gutsche. Plötzlich kamen Panzer T-34
und hielten ihre Kanonen auf unsere Häuser. Wir,
meine Schwester und ich, warteten auf unsere
Eltern, aber es vergingen Stunden und niemand
kam. Meine Schwester nahm mich an die Hand
und wir liefen im Kugelhagel über die Straße zu
unserem Haus. Die Haustür stand weit offen und
meine Schwester schrie laut auf und riss mich
zurück. Wir liefen wieder zu den Nachbarn. Ich
wusste im Moment gar nicht, was los ist. Bei
Gutsches angekommen, sagte meine Schwester,
dass unsere Eltern erschossen im Haus liegen.
Mein Vater im Korridor mit Kopfschuss und
meine Mutter auf der Treppe zum Obergeschoß,
blutüberströmt.
Dieser Tag, mein 13. Geburtstag,
verfolgt mich das ganze Leben lang. Es war
schrecklich. Im Februar wurde bei uns im Garten
ein Feuer gemacht, die Erde aufgetaut und meine
Eltern in Decken gehüllt unter dem Kirschbaum
begraben. Ich selbst durfte nicht dabei sein. Es
waren Frau Gutsche, ihr Sohn Günter und meine
Schwester, welche das Grab ausgehoben haben.
Leider verbieten mir die heutigen Besitzer unseres
Elternhauses das Betreten des Grundstücks.
Ich würde gern einmal einen Blumenstrauß
zur Ruhestatt meiner Eltern bringen, aber die jetzigen
Bewohner verweigern jeden Kontakt mit uns.
Ein großes Dankeschön geht an Familie Gutsche,
die uns liebevoll aufgenommen hat. Im Januar
1945 war Frau Gutsche, Mutter von 8 Kindern und
hochschwanger, mehrmals von den Russen vergewaltigt.
Am 17. März wurde ihr kleiner Sohn
Gustav Gregor sehr krank geboren. Der kleine
Sohn starb auf der Flucht. Das tote Kind wurde 5
Tage lang, auf den Handwagen gebettet, mitgenommen
und dann kurz vor Frankfurt/Oder
irgendwo begraben“ (GONDEZKI 2007).GUTSCHE (2001) berichtete, dass in der Stadt und in der näheren Umgebung Richtung Pieske über 50 tote Zivilisten und 40 gefallene Soldaten gezählt wurden. Diese wurden an Ort und Stelle beigesetzt.
„Borsian wurde bei einer Razzia festgenommen
und nach Landsberg gebracht. Er
stand mit drei Kreuzen auf der polnischen schwarzen
Liste und ist erschossen worden“Was geschah mit Meseritz?
Alle Zeitzeugen berichteten von Bränden, wie die aneinander gereihten Aufzeichnungen bezeugen.
„Unser armes Meseritz sah unbeschreiblich verwüstet
aus. Fast 300 Häuser zählten wir, die ausgebrannt
waren. Nacheinander fiel ein Stadtteil
nach dem anderen offenbar planmäßiger Brandstiftung
zum Opfer. Von dem Viereck Obrastraße
– Hohe Straße – Wiedener Straße – Markt sind nur noch die Häuser von Drebert und Meckes stehen
geblieben. Die Hohe und Bahnhofstraße fast
gänzlich zerstört. Darunter auch dein Haus und
Schorsecks Wohnung. Die Schulstraße, auch
teilweise die angrenzenden Stallungen der
Obrastraße, unsere auch, sind ein Raub der Flammen
geworden. Das Arbeitsamt und anschließende
Häuser, Landgericht und Landratsamt,
Kasernenhauptgebäude, Gymnasium, Deine Villa
gegenüber dem Landratsamt sind ausgebrannt.
Teile der Brätzer und Grabenstraße, die
Schloßstraße vom Schloßbräu bis zur Ecke, also
auch die Waschanstalt, ebenfalls verbrannt.“
(KLOSE o. J.)„Die Feuersbrunst nach einigen Tagen (1. oder
2. Februar) muss erwähnt werden. Die Ostseite
des Marktplatzes sowie die Seite von Foto-Meyer
brannten lichterloh und restlos nieder. Außerdem
brannten noch einige andere Gebäude in der Stadt
ab. Der Dachstuhl der Kaserne wurde mutwillig
abgefackelt. Mit Wassereimern bewaffnet musste
die Bevölkerung mit Wasser aus der Packlitz löschen.
Unsere beiden Friedhöfe wurden verwüstet,
ja geschändet“ (GUTSCHE 2001).„Jede Nacht Brände. In einer Nacht brannte
ein ganzes Viertel runter, angefangen von Bäcker
Koschitzki, die östliche Markthälfte bis hinauf zu
Schreiber, alles ein Schutt- und Trümmerhaufen.
Es blieben nur stehen Eckhaus Drebert und der
Nazibonze nebenan in der Wiednerstraße. In der
2. Nacht brannten bei uns draußen Buses Haus
und Häuser, wo Miesch und Polizeimeister wohnten.
Dann kam die Hitlerstr. an die Reihe, Seltmann
bis Meyer. Die Stadt bot ein Bild der Verwüstung,
die Straßen kaum passierbar. Brände gab es
weiterhin“ (MORGENSTERN 1981).Etwa gegen Ende Februar rief der Kriegskommandant die männliche Bevölkerung zu einer Sitzung zusammen. Eine Feuerwehr, der alle Einwohner anzugehören hatten, unter Sattlermeister Kintzel und Stellmacher Pietsch wurde gegen die dauernden Brände eingesetzt.
„Als es dem Kommandanten zu viel wurde, wurden
wir Männer zusammengerufen. Auf Vorschlag
von Rechenberg wurde ich zum Feuerwehrkommandanten
ernannt. Aber, kein Strom, kein
Wasserwerk arbeitete. Mit den kleinen Luftschutzspritzen
und mit Gießen musste gearbeitet werden.
Alle im Entstehen begriffenen Feuer konnten
gelöscht werden, die Frauen mussten Wasser
von den noch vorhandenen Pumpen, aus der
Obra oder der Packlitz tragen. Jedoch abends um
17 Uhr bis morgens um 7 Uhr durfte niemand auf
die Straße, also war auch das Löschen vorbei.
Die Nächte waren blutrot, bis es dem Kommandanten
wieder zu viel wurde und ich die Erlaubnis
erhielt, auch in der Nacht zu löschen. Der Kommandant
suchte uns in den ersten Tagen täglich
auf, um festzustellen, ob wir belästigt wurden. Ich
kann berichten, dass er ein guter Mensch war“
(PAUL KINTZEL 1981).Dennoch wurde vieles, was nicht verbrannte, mutwillig restlos zerstört und unvorstellbar verwüstet und ausgeraubt. Die Betten wurden aufgeschlitzt und in die Federn wurde – ich drücke es ganz drastisch aus – reingeschissen. Später, als die Propaganda in der Sowjetischen Besatzungszone und in der nachherigen DDR von den sowjetischen Kulturbringern schwätzte, wurde von den Erwachsenen sofort an jenen Tatbestand erinnert. Der Terminus „Tag der Befreiung“ wurde sofort ergänzt als „Befreiung von Hab und Gut“. Als dann das Schulfach Englisch durch Russisch abgelöst wurde, war Russisch für viele von uns immer noch die Sprache des Feindes.
Rückkehr nach Meseritz
„In Meseritz angelangt, stieg ich auf dem Topfmarkt
vom Wagen, traf Frau Lody, die mir manches
über die Zustände in Meseritz erzählte und
mich zu Sattlermeister Kintzel brachte. Die Stadt
selbst sah verheerend aus. Das ganze Viertel
Schreiber, Eichholz usw. und unsere Ecke waren
bis auf Meckes und Drebert heruntergebrannt.
Furchtbar waren die Brände bei Meyer und Ulbrich.
Kintzel brachte mich zu Bäckermeister Wagner,
der für die russischen Truppen Brot zu backen
hatte. Er nahm mich bis zu meiner Gefangennahme
sehr freundlich auf“ (KOSCHITZKI 1970).Einer der ersten ehemaligen deutschen Soldaten, die nach Meseritz zurückkehrten, war der Ackerbürger Wolff jun., der Vater meines Spielkameraden Erich Wolff aus der Mühlstraße. Alle waren überrascht. Vater Wolff musste sich beim Stadtkommandanten melden; nach dem Erzählen war selbst der Kommandant vom Auftauchen eines ehemaligen deutschen Soldaten überrascht und - schickte ihn wieder nach Hause! Die Zahl der nicht geflüchteten Meseritzer und die Zahl derjenigen, die bis zum Tag der Vertreibung am 26. Juni 1945 wieder zurückkehrten, wird unterschiedlich angegeben. KLOSE ist der Meinung, von der Zivilbevölkerung blieben etwa 800 Personen zurück. Diese Zahl erhöhte sich ständig durch zurückkehrende Flüchtlinge bis auf etwa 2.500 (KLOSE o. J.). DITTMANN, der mit seiner Familie am 5. März 1945 nach Meseritz zurückkehrte, schätzte die damalige Bevölkerung auf 2.000 Personen (DITTMANN 2010).
Leben der deutschen Bevölkerung unter den Russen
Die Bewohner der Kirchstrasse 16, die in Meseritz geblieben waren, zogen alle auf Vorschlag meines Vaters in die erste Etage, in die Wohnung der Familie Ebel. Offensichtlich suchten in dieser ungewissen und turbulenten Zeit die Menschen die Nähe zu anderen Menschen. Die Zentralheizung in der Wohnung von Ebels hat sicher auch eine Rolle in den Erwägungen gespielt. Da die Wohnung in der ersten Etage lag, wurde sie auch nicht so stark wie die Erdgeschosse von den sowjetischen Soldaten frequentiert. Bei Feuer konnte man über das Küchenfenster auf die Dächer der angrenzenden Holzställe flüchten (später ein beliebtes Spiel von uns Jungen). Somit war diese Wohnung unter den damaligen Umständen die „sicherste“ Wohnung, wenn man überhaupt von Sicherheit sprechen kann.
„Ich sagte allen, die im Hause waren, dass wir
zusammen in Ihre Wohnung zögen. Schechner,
Frau Handke, eine fünfköpfige Familie, die noch
im Hause war, dazu kam dann noch eine
Flüchtlingsfrau mit zwei kleinen Kindern, einige
Tage später Frau Nagel mit einem Enkel und Frau
Metzer. Alles lebte in den hinteren Räumen. Am
Tage erhielten wir nun dauernd Besuch. Nachts
lagen wir in den ersten Wochen in den Kellern.“
(PAUL KINTZEL in einem Brief an seinen Hauswirt
Dr. Ebel, P. KINTZEL 1981).Mir war es damals als Kind unbegreiflich, dass man so einfach – ohne Erlaubnis – in fremde Wohnungen ziehen konnte, ich sollte aber in den kommenden Wochen noch ganz andere Fakten und Vorgänge „begreifen“.
„Die folgenden Tage waren sehr kalt. Es gab
kein Wasser, keinen Strom und der Hunger plagte
uns. Wir Kinder schliefen alle in einem Raum
auf der Erde und die Russen schossen über unsere
Köpfe durch die Fenster. Heizen konnten wir
nicht und so wärmten wir Kinder uns gegenseitig.
Frau Gutsche und meine Schwester waren die einzigen
Erwachsenen im Haus. Wir Kinder mussten
Schnee in Töpfen holen, um etwas Trinkbares zu
haben. Wenn wir Schnee holten, stolperten wir
über tote und verwundete deutsche Soldaten.Viele
schrien verzweifelt. Die Russen trieben uns mit
ihren Gewehrkolben wieder ins Haus zurück. Der
Hunger trieb uns, trotz der Angst, in die von den
Russen zerstörten und verdreckten Geschäfte, um
dort nach etwas Essbarem zu suchen. Meistens
ohne Erfolg, da vieles ungenießbar war. Gott sei
Dank fanden wir in der Molkerei noch einige Kisten
Camembert-Käse. Damit war der Hunger erst
einmal gestillt. Seitdem steht der Camembert-
Käse öfter auf meinem Speiseplan“ (GONDEZKI
2007).Ein Problem war die Versorgung mit Trinkwasser. Einige Familien holten das Kochwasser aus der Packlitz, es schmeckte aber selbst im Malzkaffee noch nach Flusswasser. Tauwasser vom Dach wurde mit Lappen aufgefangen, um es zur Körperreinigung zu verwenden. Um eine Versorgung mit Wasser zu garantieren, wurden von den Bewohnern der Kirchstraße 16 Eimer und Badewannen mit Schnee gefüllt und so aufbewahrt. Bei Tauwetter wurden Regentonnen genutzt, die das ablaufende Wasser von Holzställen und der Werkstatt meines Vaters auffingen. Auf manchen Gehöften gab es noch Pumpen, die genutzt werden konnten.
„Gertrud und ich gingen trotz aller Russen „requirieren“,
denn wir mussten uns wieder Lebensmittel
und Sachen anschaffen. Wohnungen und
Keller wurden durchsucht und alles Essbare mitgenommen,
trotz vereinzelter Russen, die sich in
den Wohnungen rumtrieben. In allen Wohnungen
war alles umgeworfen und zerschlagen, dass man
kaum treten konnte. Alle Sachen waren aus den
Behältnissen gerissen und lagen zerstreut am
Boden. So auch im Keller“ (MORGENSTERN
1981).In der Kirchstrasse, kurz vor der katholischen Kirche, befand sich der ehemalige Laden von „Zigarren- Hanke“, der von der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) als Lebensmitteldepot und Verteilerstelle für die Versorgung der durchziehenden Flüchtlinge genutzt wurde. Dort lagerten am 30. Januar neben hunderten geschnittenen Brotscheiben auch Dauerwürste, Butter, Kekse und Biomalz. Von dort wurden Lebensmittel „organisiert“, wieder ein neues Wort, das ich bis dahin nicht kannte. Die Butter ging uns bald aus, aber wir hatten viele Büchsen mit Biomalz als Brotaufstrich, welches ich damals zum ersten Male aß. Außerdem befanden sich in den Kellern der Bewohner der Kirchstr. 16 – es wohnten dort die Familien des Friseurmeisters Schechner, der Uhrmacherin Handke, des Rechtsanwaltes Ebel, des Oberstaatsanwaltes Preuß und des Sattlermeisters Kintzel – viel eingekochtes Gemüse und Obst („Eingemachtes“) und vor allem Kartoffeln.
Es war ja damals in Meseritz so üblich, dass im Herbst nach der Kartoffelernte die Kartoffeln eingekellert wurden. Gehungert haben wir nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich großen Durst hatte, als wir in den ersten Tagen im Keller hausten. Mein Vater öffnete ein Glas mit eingeweckten Birnen, an dem Birnensaft konnte ich mich dann laben.
Wir Kinder durften in diesen Tagen zum Spielen nicht auf den Hof und wurden ständig ermahnt, nicht laut zu sein. Ich höre noch immer den häufigen Hinweis „Der Nachwuchs soll ermordet werden“. Vielleicht war es auch so, dass man die Anwesenheit der Bewohner in dem Haus verschleiern wollte.
An Brot mangelte es uns auch nicht, denn der lange Hof der Kirchstr. 16 führte auf der Rückseite bis an die Bischofstr. gegenüber von Bäcker Albert Wagner, der für die Rote Armee Brot backen musste. Dabei fiel für die deutsche Bevölkerung der Umgebung Brot ab, ich meine, dass mein Vater öfter Brot an andere Menschen abgab, das er besorgt hatte, und die es dann bei uns abholten. Wenn ich heute die folgende Passage aus dem Bericht des Bäckermeisters KOSCHITZKI lese, frage ich mich immer wieder, wie es angestellt wurde, um die deutschen Zivilisten mit Brot zu versorgen.
„An Zivilisten durfte kein Brot ausgegeben werden,
denn ein russischer Posten stand Tag und
Nacht vor der Bäckerei, dennoch war es mir möglich,
an Vater und Martha Baum sowie Christa
Chrzonsz Brot abzugeben. Wenn wir uns auch
über ein Wiedersehen sehr freuten, so war das
Auseinandergehen recht wehmütig, da man ja
nicht wusste, was uns bevorstand“ (KOSCHITZKI
1970).Gegenüber den Plünderungen waren die Deutschen am Anfang machtlos und rechtlos, im schlimmsten Fall wurde von den Russen mit der Waffe gedroht. Mein Vater ging meistens mit den Russen in die leerstehenden Wohnungen in unserem Haus mit, weil immer die Gefahr der Brandstiftung bestand. Dreimal wurde in der Kirchstraße 16 ein Brand gelegt, den mein Vater aber rechtzeitig löschen konnte. Als mein Vater eines Tages wieder mit einem Russen in die Wohnung des Oberstaatsanwaltes mitging, entdeckte der Russe im Kleiderschrank, sauber und ordentlich aufgehängt, eine hellbraune SA-Uniform samt Dolch. Diesmal musste mein Vater einen Schutzengel gehabt haben, er nahm die Uniform, zog sie am Hintern vorbei und deutete „Schei…..“ an. Der Russe grinste verständnisvoll und wandte sich anderen Dingen zu. Nie habe ich meinen Vater so aufgeregt gesehen, als ich danach Schmiere stehen musste und er die Uniform auf dem Boden unter die Dachsparren des dreistöckigen Hauses „entsorgte“. Das hätte für alle Bewohner auch anders ausgehen können, denn aus den Erzählungen der Erwachsenen weiß ich, dass Überlebende berichteten, wie Russen sich verhielten, wenn nazistische Symbole und Uniformen gefunden wurden.
Als dann die Bevölkerung von Meseritz gegen Ende Februar in ein bestimmtes Viertel am Westrand umsiedeln musste, übernahm mein Vater die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Woher er wusste, wo es etwas zu „organisieren“ gab, entzieht sich meiner Kenntnis, doch sicher waren es auch Tipps anderer Meseritzer gewesen. Geholt wurden diese Lebensmittel aus dem von der deutschen Bevölkerung entblößten Teil der Stadt. Diese Lebensmittel wurden zunächst mit einem Handwagen transportiert, der von meinem Opa, Johann Päch von der Winitze, und Herrn Bläsing gezogen wurde. Mein Vater mit einer roten Armbinde und der Aufschrift „Feuerwehr- Kommandant“ konnte fast ungehindert durch Meseritz streifen.
Drei Dinge blieben in meinem Gedächtnis haften: Im Schlachthaus fand mein Vater Speckseiten, die geholt wurden. Nun waren z. B. alle Frauen in der Scheidingschen Wohnung tagelang damit beschäftigt, den Speck in Würfel zu schneiden und Schmalz auszubraten. Das letzte Schmalz haben wir noch im Juni 1945 mit auf den Treck genommen, als wir aus Meseritz vertrieben wurden. Es gab auch viel Sirup, ebenfalls noch mit auf den Treck genommen, der aus den Schnitzeln der Zuckerfabrik stammte.
Einmal erfuhr mein Vater, dass auf dem Gelände des Krankenhauses Kohl eingemietet worden war, den er holen wollte. Irgendwelche Russen hinderten ihn aber daran. Er ging also zum russischen Kommandanten und bekam in Russisch und deutsch eine Bescheinigung („Propusk“ oder auch „Dokument“), dass er vom Gelände des Krankenhauses Kohl holen könne, was dann auch geschah.
Dazu eine humoristische Einlage: Als wir auf dem Treck waren, hielt uns Anfang August 1945 ein russischer Posten an, wollte uns mit dem Handwagen nicht weiterfahren lassen und verlangte ein „Dokument estj“. Wir hatten ja nichts.
Da fiel meinem Vater das „Kohlschreiben“ aus Meseritz ein. Er hielt es dem Russen hin, der sah kyrillische Buchstaben und einen Stempel, gab es meinem Vater zurück und sagte „Pascholl“, wir durften also weiterfahren. Die Lebensmittel, die mein Vater und seine Helfer organisierten, kamen in den Laden von Kaufmann Nass, von dort wurden sie an die Bewohner verteilt. Einige Bewohner hielten sich dann auch wieder Hühner und Kaninchen.
„Etwa gegen Ende Februar rief der Kriegskommandant
die männliche Bevölkerung zu einer
Sitzung zusammen. Die Kommandantur war
am Markt in den Häusern Wilke, Dr. Gaetgens und
Massow untergebracht mit allem Komfort (geklaute
Möbel, Teppiche, Bilder usw. und viel „Rot“)
ausgestattet. Durch den Mund der Dolmetscherin
erfuhren wir den Zweck der Versammlung, nämlich
die Bildung eines deutschen Stadtparlaments
mit Bürgermeister und Vertrauensleuten.
Als Oberbürgermeister fiel die Wahl auf Rechtsanwalt
Szotowski mit Herrn Schreiber (vom Gericht)
als Dolmetscher. Unter den Vertrauensleuten
waren u. a. Kaufmann Kusserow und dessen
Schwager Schelske, Wehling vom Gericht, Korbmacher
Hein, Gastwirt Beder und Sandau, Kaufmann
Kruschel, Bäcker Wagner, Ackerbürger
Kutzahn, Schneider Kaatz, Schuhmacher Kaulich,
Lehrer Zahn und andere mehr. Es sollte, so hieß
es, von nun an besser werden. Wir sollten wieder
aufbauen. Es sollte Brot für die Bevölkerung beschafft,
in Heidemühle das Mehl dazu gemahlen
werden, elektrisches Licht in der Stadtmühle erzeugt
werden. Eine Feuerwehr, der alle Einwohner
anzugehören hatten, unter Sattlermeister
Kintzel und Stellmacher Pietsch wurde gegen die
dauernden Brände eingesetzt“ (KLOSE o. J.)Eines Tages kam mein Vater, der sich in die Stadt gewagt hatte, mit der Nachricht zurück, dass er vom russischen Kommandanten zum Feuerwehrkommandanten ernannt worden sei. Der Vorschlag kam von dem Dachdecker Stanislaus Rechenberg, der auch polnisch sprach. Es sollen auch in der Stadt Meseritz angeschlagene Zettel vorhanden gewesen sein, die sich mit bestimmten Forderungen der russischen Kommandantur an die Meseritzer richteten.
Auf alle Fälle war es so, dass Radios, Telefone und Schreibmaschinen abgeliefert werden mussten. Die Möglichkeiten der Brandbekämpfung waren aber sehr primitiv, denn eine Motorspritze war nicht vorhanden, mit Kübelspritzen und Luftschutzspritzen wagte man sich an die Brandbekämpfung. Später waren diese Spritzen dann für uns ein beliebtes Spielzeug.
Anfang Februar wurde die Deutschen, die nicht geflüchtet waren, in den Westteil der Stadt umgesiedelt, das Gebiet durfte ohne Erlaubnis nicht verlassen werden. Ich hörte die Aussage, dass die Konzentration auf ein bestimmtes Gebiet von Vorteil für die Kommandantur sei, um uns besser schützen zu können. Ich weiß noch, dass ein Soldat der sowjetischen Kommandantur von uns Kindern immer „Iwan“ gerufen wurde, offensichtlich hieß er auch so. Das war ein sehr konsequenter Soldat, der fast immer zur Stelle war. Wir Kinder liefen nur auf die Mühlstraße und schrieen „Iwan“, schon war er da und hat mit dem Kolben seiner MPi so manchen Russen verdroschen, der plündern oder sich an einer deutschen Frau vergreifen wollte. Nur wenn Truppen von der Front in die rückwärtige Etappe verlegt wurden, waren Kommandant und seine Soldaten machtlos. Diese Truppen durften sich dann „austoben“.
Ein kleiner Russe von der Sowjetkommandantur auf dem Markt, von uns als „Malenki“ (russ.: klein) genannt, ritt immer in feurigem Tempo durch das große Tor im Bretthauerschen Haus in den Hof, war freundlich zu uns Kindern und hielt sich gern bei einer Familie auf, die drei heranwachsende Töchter hatte, ohne ihnen aber zu nahe zu treten. Es gab aber auch andere Fälle, die Tochter der Frau R., damals 12 Jahre alt, wurde von den Russen vergewaltigt.
Die deutschen Frauen und heranwachsenden Mädchen wurden unter russischer Bewachung zu Arbeitseinsätzen herangezogen, mussten Wohnungen aufräumen und bestimmte Sachen wie Radios usw. einsammeln, die später in der Kaserne deponiert wurden. Öfter musste meine Mutter zu solchen Arbeitseinsätzen. Eine bevorzugte Stellung besaßen manche Handwerker, zwei Beispiele mögen das illustrieren. „Bald in den ersten Tagen in der Siedlung wurde ich als Uhrmacher bekannt. Ein jüdischer Kommissar suchte mich dann auf und bat mich, für die russische Kommandantur zu arbeiten. Ich hatte es dadurch im Gegensatz zu meinen übrigen Leidensgefährten sehr gut und konnte infolge dessen in der Kolonie viel Leid mindern helfen. Selbst die GPU schützte und unterstützte mich, wo sie nur konnte. Ich hatte Lebensmittel und Leckerbissen im Überfluss und genoss bei der Kommandantur dadurch eine bevorzugte Sonderstellung (KLOSE o. J.).
Der Schneider MORGENSTERN (1981) beschrieb seine Lage so:
„Am dritten Tag, als wir schon dort (gemeint ist die Umsiedlung an den
westlichen Stadtrand, W. K.) wohnten, kam der
Dolmetscher vom Stadtkommandanten, ein junger,
freundlicher Mensch, Student, und jetzt natürlich
Soldat. Er sprach sehr gut deutsch. Er erklärte,
er habe gehört, dass ich gute Breecheshosen
mache und wollte einer haben. Er brachte dazu einen Mantel mit. Ich machte sie, er war sehr
zufrieden und sagte, er würde mir weiterhelfen.
Nach zwei Tagen musste ich zum Kommandanten
kommen, dort wurde mir gesagt, ich sollte eine
Schneiderwerkstatt aufmachen und zwar im
Schlachthof, Wohnung Direktor. Hier wurden zwei
Stuben und Küche geleert – alles zum Fenster
raus und die Werkstätte eingerichtet. Drei Maschinen,
Zuschneidertisch, zwei Arbeitstische usw. Ich
fand auch gleich Näherinnen, ein älteres Fräulein
aus Tirschtiegel, eine junge Frau aus Betsche
(beide hatten ihre Stadt verlassen) und Gertrud.
Auf diese Weise brauchten die Frauen nicht
mehr an den Aufräumungsarbeiten teilzunehmen.
Frau Höhne kochte und besorgte die Wirtschaft.
In zwei Tagen war alles fertig und es konnte gearbeitet
werden. Beide Frauen waren perfekte
Schneiderinnen und Gertrud wurde von mir angelernt,
oft unter heißen Tränen. Wir machten
Breecheshosen, Kellnerjacken, weiß, ebenso
weiße Kopftücher für Serviererinnen im Kasino,
Oberhemden, Taschentücher und dergleichen. So
ging es vom 15. 2. bis zum 15. 5., Dienst 10 Stunden,
abends 18.00 Uhr war Schluss.
Im Schlachthof wurde wieder geschlachtet, mit
dem russischen Schlächtermeister war bald
Freundschaft geschlossen, er wollte ja auch manches
gemacht haben und so hatten wir hinreichend
zum Leben. Außerdem bekamen wir alle
sechs Tage Brot, Fleisch, Wurst, Butter, Mehl, in
bestimmten Mengen. Drei russische Posten bewachten
unsere Räume und wohnten nebenan.
Alle drei fabelhafte ältere Leute und freundlich
noch und noch. Auch mit diesen hatten wir Freundschaft
geschlossen, es ging alles sehr exakt zu.
Wenn die frühstückten, in Speck gebratene Kartoffeln,
gab es immer was ab und oft konnte man
das Fett noch löffeln. Geld gab es nicht. Wir lebten
aber gut. Ich bekam einen Ausweis, dass ich
die Stadt passieren konnte und wir gingen so alle
zusammen zum Dienst. Auf diese Weise konnten
wir uns das Elend in Meseritz aus der Nähe betrachten.“Ein russisches Demontierungskommando begann ab Mai 1945 die technische Ausrüstung der Molkerei auszuschlachten. Alles, bis auf das letzte Stückchen Rohrleitung, wurde ausgebaut. Eine Wand des Kesselhauses wurde eingeschlagen, um den Kessel herauszubekommen.
Männer, Frauen und Jugendliche wurden zu unterschiedlichen Arbeiten herangezogen. Der Jugendliche G. Gutsche schrieb darüber:
„Wir mussten
alle lebenden Tiere eintreiben, welche später
im Schützenhaus, größeren Gehöften und Gütern
untergebracht wurden. Nur ein kleiner Teil blieb
für die Polen und die Deutschen. Der Rest wurde
in die Sowjetunion abtransportiert. Mädchen und
Frauen wurden gezwungen, in den Häusern die
verwüsteten Wohnungen wieder in Ordnung zu
bringen. Einige Tage mussten wir den Beutekunst-
Soldaten der Russen helfen, alles Wertvolle aus
den Häusern zum Bahnhof zu tragen und in Waggons
zu verladen. Insgesamt gingen etwa 30
Waggons aus Stadt und Land nach Russland.
Anfang März 1945 mussten wir nach Kainscht zur
Feldarbeit. Dort legten wir Kartoffeln; Mais,
Sonnenrosen und Hafer wurden ausgesät. Zum
Wochenende konnten wir nach Hause und
Sonntagabend mussten wir wieder da sein“„Inzwischen hatten wir Acker zur Saat klargemacht.
Da wir keine Pferde hatten, spannten
sich 6 Frauen vor den Pflug und vor die schwere
Egge. Kartoffeln legten wir mit der Hand in den
Boden – so haben wir gewirtschaftet. Erst im Juni
bekam ich von den Polen zwei Pferde, zwei erbärmliche
Kracken“ (ostpreußischer Ausdruck für
minderwertige Pferde) (DITTMANN 2010). Mein Vater (er durfte sich ja als Feuerwehrkommandant frei in der gesamten Stadt bewegen.) holte aus den Gärtnereien dort noch vorhandenen Samen, ließ ihn in Tüten abfüllen, damit jeder etwas bekam. Auch verteilte er Saatkartoffeln.
Am 20. Mai, Pfingstsonntag mit prachtvollem Frühlingswetter, wurden unter der Regie meines Vaters besitzerlosen Gärten innerhalb des Teils von Meseritz, der von der deutschen Bevölkerung bewohnt war, vergeben, um sie zu bestellen. Keiner ahnte, dass die Meseritzer 5 Wochen später schon ihre Heimatstadt verlassen mussten.
Verschleppung
Bis zur Vertreibung am 26. Juni 1945 wurden viele Meseritzer, meistens Männer unter 50 Jahren, aber auch ältere, verschleppt. Frauen und heranwachsende Mädchen wurden ebenfalls verschleppt. Mehrmals wurden solche Transporte zusammengestellt. Uns liegen dazu wenige Berichte vor, wir wissen auch über viele Einzelschicksale nichts, weil die Verschleppten, die in die sowjetische Besatzungszone bzw. DDR zurückkehrten, sich in der damaligen Zeit nicht schriftlich geäußert haben. Glück im Unglück hatte der Uhrmacher Klose, der für einen solchen Transport schon über Nacht im Rathauskeller eingesperrt war. Im letzten Moment wurde er von einem Offizier der russischen Kommandantur herausgeholt.
Ob auch die von G. Gutsche wiedergegebene Schilderung einer Verhaftung die Vorstufe eines solchen Transportes sein sollte, entzieht sich meiner Kenntnis.
„Mitte Februar kann es gewesen
sein, da wurden alle männlichen Personen
von 14 bis 70 Jahren von dem NKWD und der
GPU abgeholt, also verhaftet. Wir wurden im Keller
bei Pfarrer Dirksen eingesperrt und laufend
verhört. Nach mehreren Tagen konnte uns nicht
nachgewiesen werden, dass wir in der Nazipartei
oder beim Werwolf organisiert waren. Trotz Schläge
bekamen sie aus uns nichts heraus. Ein Ausweis
der KPD meines Vaters und die Forderung
der Polen, welche Arbeitskräfte brauchten, brachte
unsere Freilassung. Wir mussten unterschreiben,
nie mehr im Leben eine Schusswaffe in die Hand
zu nehmen“ (GUTSCHE 2001).Von seiner Verschleppung berichtete der Bäckermeister Koschitzki:
„Von der Kommandantur
wurde ein Aushang angebracht, wonach sich
alle männliche Personen vom 17.-50. Lebensjahr
bis zum 27. 2. zu melden hatten, darunter fiel auch
ich. Wagners versorgten mich mit Kleidung und
Lebensmitteln. Am 27. 2. wurde ich vormittags in
das Rathaus mit vielen anderen, darunter 46 Mann
aus Obrawalde, eingesperrt. Letztere waren schon
länger dort und halb verhungert. Am 28. 2. marschierten
wir gegen 15 Uhr, etwa 300 Mann, in
Richtung Schwerin/Warthe. Dort angekommen, in
einem Raum dichtgedrängt untergebracht, führten
wir, bei einer Verpflegung von 5 Pellkartoffeln
pro Tag, ein fürchterliches Dasein. Wir wurden zum
Brückenbau über Warthe und Obra eingesetzt und
blieben dort 11 Tage. Die Arbeit war sehr schwer,
besonders das Einrammen der großen Holzpfähle
mit einem Holzklotz, den 6 Mann immer hochheben
mussten. Primitiv wie vor 1.000 Jahren.
Nach Fertigstellung kamen wir nach Landsberg
a/W. und wurden dort in der Kaserne untergebracht,
wo unser Gepäck durchsucht und vieles
abgenommen wurde. Gegen Abend rückten die
ersten Kameraden zum Abtransport an, wir hatten
noch bis 2 Uhr nachts zu tun. Auf unser Bitten
hin, uns unsere Sachen vom Lager holen zu dürfen,
wurden wir einfach zu 45 Mann in einen Waggon
eingesperrt und nun ohne unsere Sachen und
Verpflegung nach Rußland gebracht. Mein Hab
und Gut waren nun noch ein leerer Papiersack,
mit dem ich Kartoffeln getragen hatte, und eine
Blechbüchse.
Wir wurden zum Aufbau eines zerstörten Elektrizitätswerkes,
welches Kress hieß, eingesetzt. Es liegt in der Nähe von Kriwoi Rog. Im ersten
Halbjahr starben manchen Tag bis 4 Kameraden,
die eben die Umstellung nicht aushielten. Von den
Kameraden aus Meseritz starben die Hälfte und
zwar der kleine Päschke aus der Schwiebuser Str.
im Alter von 16 Jahren, Postinspektor Kaldenbach,
Hindenburgstr., Schlossermeister Ruff, Bischofstr.
Von den anderen weiß ich leider die Namen nicht
mehr. Lokführer Karlson, Schulstr., der Treckerfahrer
von W. Bredemann, Heidemühle, und zwei
andere Kameraden sind im Sommer 1945 von
ihrer Arbeitsstelle ausgerückt, um nach Hause zu
wandern. Ob sie ankamen? Ackermann, G. Weher,
Schuhmacher, Lutschak, Gärtner Pohl und
ich hielten bis zur Entlassung durch“
(KOSCHITZKI 1970).Ein couragiertes Auftreten rettete H. Dittmann vor der Verschleppung und in seinem Falle vor dem sicheren Tod.
„Was mit den Männern geschieht,
die über Schwiebus, Posen nach Russland
gekommen sind, weiß ich nicht. Es wurden
in Meseritz verschiedene Male Transporte zusammengestellt,
die zunächst nach Landsberg gingen.
Am 13. März 1945 war ich auch dabei. Als ich
dem Dolmetscher klarmachen wollte, dass ich mit
meiner Beinprothese gar nicht bis Landsberg
marschieren könne, sagte er, das wäre gleichgültig,
ich müsse mit. Da jeder, der unterwegs zurückblieb,
weil er nicht weiterkonnte, erschossen
wurde, trat ich aus der Reihe der angetretenen
Männer heraus und ging zu dem vor dem Rathaus
stehenden Offizier. Ich bat ihn, er möge mich
hier gleich an Ort und Stelle erschießen, das sei
mir lieber als erst nach 3 oder 4 km. Er befühlte
meine Prothese und schickte mich nach Hause“
(DITTMANN 2010).Es war wohl schon im März (war es der 13. März?), als auf dem letzten Ende der Hinterstraße, kurz vor Einmündung in die Mühlstrasse, Männer zusammengetrieben wurden, die verschleppt werden sollten, was mit vielen auch geschehen ist. Mein Vater stand auch in der Ansammlung, ich war in seiner Nähe. Er gab mir den Auftrag, ihm von seinem Sattlergarn schnell, ehe er weg müsse, ein Stück zu holen, weil ein Schnürsenkel gerissen war. Ich lief schnell über die Straße und holte ihm Sattlergarn, leider war es nicht das richtige. Ich fürchtete nun ein Donnerwetter, aber mein Vater blieb – entgegen seinem sonstigen Naturell – ganz ruhig, schickte mich auch nicht mehr weg.
Später, als ich selbst Kinder hatte, ging mir diese Situation immer wieder durch den Kopf, glaubte ich auch, die Handlungsweise zu verstehen. In dieser Situation war wohl meinem Vater gegenwärtig, dass er wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren werde, ein Abschied von seinem Sohn im Zorn wollte er nicht. Wieder einmal gab es einen Schutzengel. Bevor der Transport erfolgte, mussten die deutschen Männer antreten und Sowjet- Offiziere gingen an ihnen vorbei und musterten sie. Mein Vater wurde nach seinem Alter gefragt und nannte „63“. Neben ihm stand der Stellmacher Pietsch, damals 52 Jahre alt, der auf die entsprechende Frage mit „58“ antwortete, beide trugen eine rote Armbinde mit der Aufschrift „Feuerwehr“. Beide wurden nach Hause geschickt.
Mein Klassenlehrer aus der 1. Klasse, Herr Zahn, damals auch schon 63 Jahre alt, wurde ebenfalls verschleppt. Wie ich später gelesen habe, ist er in den Sümpfen Kareliens umgekommen. Einer ehemaligen Schülerin, die als junge Frau ebenfalls verschleppt wurde, klagte er, dass er keine der Witterung angepasste Kleidung besitze und sehr frieren würde.
Kindheit ohne Schule
Mai und Juni 1945, nach der Kapitulation („Gitler kaput, woina kaput“), waren für uns Kinder dann eigentlich unbeschwerte Tage, Schulunterricht und Hausaufgaben gab es nicht. An den Tag der Kapitulation habe ich keine Erinnerung, nur an ein Erlebnis vom 1. Mai. Es gab an diesem Tag betrunkene Russen auf der Mühlenstraße. Als einer, der schon mehrmals vor Trunkenheit zu Boden gegangen war, in die Schlossmühle eindringen wollte, wurde er von einem Offizier daran gehindert. Als der betrunkene Russe sich widersetzte, zog der Offizier seine Pistole und richtete sie auf ihn.
Unser Spielplatz war vor allem die Burg, wo wir unumschränkte Herrscher waren, es störte uns Kinder keiner. Leider musste ich auch erleben, wie ein russischer Soldat auf dem Schlossvorhof einen Storch vom Dach herunterschoss, den wir dann begraben haben. Ein Eldorado war für uns auch die Packlitz, besonders oberhalb der Schlossmühle.
 |
|
Kinderparadies Packlitz
(Archiv HGr) |
Der Abschnitt vor dem Garten der Färberei Klein, durch den kaputten Zaun von Ebels Garten leicht zu erreichen, hatte einen sandigen Untergrund und klares Wasser. Von der Schöpfbank konnten wir ins Wasser springen. Wir hatten uns Flöße gebaut, die wir auf dem Grundstück vom Ackerbürger Wolff verankert hatten. Von dort unternahmen wir dann unsere Fahrten, wagten uns aber nicht zu dicht an die Mühle, weil wir Angst hatten, in den geöffneten Mühlenschütz hineingezogen zu werden.
Wir erlebten aber auch, wie die Russen mit Eierhandgranaten in der Packlitz fischten. Der Fischbestand war zur damaligen Zeit besonders in der Packlitz vor der Einmündung in die Obra reichhaltig, denn viele tote oder zerfleischte Fische schwammen nach der Explosion im Fluss.
Ebels Garten wurde von meinem Vater, aber besonders von meinem Opa, bearbeitet und im Frühjahr 1945 bestellt. Einmal hatte ich bei sehr kaltem Wetter von meiner Mutti den Auftrag bekommen, zum Opa in den Garten zu gehen. Dort angekommen, fragte mich mein Opa: „Was willst Du denn bei dem kaltem Wetter hier im Garten?“ Meine Antwort war „spielen“. Der Hintergrund war aber ein anderer. Ich sollte auf meinen Opa aufpassen. Russen (oder Polen?) hatten die Kellerluke entdeckt und ihm seine paar Habseligkeiten geplündert. Er hatte wirklich nur noch das, was er auf dem Leibe hatte. Meine Mutti befürchtete nun, dass er sich was antun würde. Meine Anwesenheit sollte das verhindern.
Wir Kinder hatten inzwischen ein paar Brocken russisch und polnisch gelernt, konnten uns auch damit leidlich verständigen, bekamen von den russischen Soldaten auch Brot und Zwiebeln, manchmal auch Butter ab, wenn sie irgendwo aßen. Auch das Drehen von „Papirossi“ hatten wir inzwischen gelernt ... Die erwachsenen Raucher fachsimpelten darüber, was man wohl am besten rauchen könne. Neben Kirschblättern und Walnussblättern empfahl der damalige Bürgermeister Szotowski meinem Vater Blütenblätter von Rosen, zur damaligen Jahreszeit müssten es wohl Pfingstrosen gewesen sein.
Allmählich durften die Deutschen auch wieder in die anderen Teile von Meseritz. Das nutzten wir Kinder besonders. Ich weiß noch, dass wir in der Bischofstraße von einem Schuppen zum anderen über die Dächer kletterten. Mit einer kleinen Leiter, die wir flach von den Holzschuppen in der Kirchstraße 16 zum Schuppen der Gärtnerei Gebauer legten, überwanden wir den schmalen Gang, der beide Grundstücke trennte. Aus heutiger Sicht waren das halsbrecherische und gefahrvolle Abenteuer, die wir durchführten. Zu Hause hätte es sicher manche Tracht Prügel gesetzt, wenn unsere Eltern das gewusst hätten.
Vertreibung aus Meseritz
Im Juni 1945 hieß es dann, wir könnten wieder in unsere alten Wohnungen zurück. Es kam aber nicht mehr dazu. Irgendwann kam das Gerücht auf, wir müssten raus aus Meseritz. Auch jetzt klammerten sich die Menschen wie im Januar (
„Die paar Panzer mit aufgesetzter Infanterie
schlagen unsere doch zurück.“) an einen
Strohhalm, der da hieß: „Die wollen doch bloß
unsere Wohnungen plündern, danach können wir
wieder zurück“. So brachten mein Vater und ich viele Sachen, u. a. Textilien und Silberbesteck in kleinen Paketen verpackt, in die Kirchstraße 16 und ließen sie unter den Dachsparren verschwinden. Gegen Ende Juni zogen Trecks aus den umliegenden Dörfern durch Meseritz, ich erinnere mich noch genau an einen Treck am 25. Juni aus Bauchwitz und Wischen, weil in diesem Treck die Frau meines älteren Bruders, der in angloamerikanischer Gefangenschaft seit 1943 war, dabei war. Viele Meseritzer hatten sich einen Handwagen besorgt, manche umwickelten die Räder mit alten Säcken und begossen die dann mit Wasser, damit die hölzernen Speichen aufquollen, um ein Auseinanderfallen der Räder in der Sonne zu verhindern.
Die nachfolgenden Augenzeugenberichte haben große Objektivität, zeigen sie doch viele Übereinstimmungen und Parallelen.
„Anfang April bemerkten wir ganz allmählich
den Zuzug von Polen. Ja, eines Tages wurde unser
deutscher Bürgermeister durch einen polnischen
(früher Spediteur in Bentschen) ersetzt.
Auch ein polnischer Landrat zog ein. Das Rathaus
wurde Sitz polnischer Behörden. Auch polnische
Polizei versah mit den Russen gemeinsam den
Streifendienst. Wir ahnten nichts Gutes, aber die
Russen dementierten bis zum letzten Tage und
behaupteten immer wieder, Meseritz bliebe
deutsch unter russischer Oberhoheit.
Dann kam am 26. Juni früh der Ausweisungsbefehl.
Innerhalb von zwei Stunden sollten wir auf
der Frankfurter Chaussee stehen. Es war furchtbar,
von dem Elternhaus und der Heimat Abschied
nehmen zu müssen. Wir hatten unsere wenige
Habe in Säcken auf einen Handwagen gepackt,
und wir drei, Kamerad Kaatz, seine Mutter und
ich, verließen das Haus. Frau Kaatz hatte uns in
den letzten Tagen bekocht. Wir haben sie
unterwegs in Erkner begraben müssen. Es ging
zu Fuß bis nach Berlin.
Unterwegs, zuerst gleich hinter Meseritz, wurden
wir 3mal von Banditen überfallen und ausgeraubt.
Über Zielenzig – Drossen – Kohlow bis
Frankfurt, wo wir glaubten, über die Oder gesetzt
zu werden. Es ging aber auf Küstrin zu. Bei Göritz
wurden wir am 1. 7. über die Oder getrieben und
landeten auf einer weglosen Wiese. So sah das
neue Deutschland aus. Kein Mensch kümmerte
sich um uns. Weiter ging es über Seelow, Müncheberg,
Erkner nach Berlin. Auf der ganzen Strecke
hat uns eine kleine Gemeinde kurz vor Berlin ein
einziges Mal eine Scheibe Brot und etwas Ersatz-
Kaffee gereicht.“ (KLOSE o. J.).„Am 26. Juni 1945 mussten wir binnen 2 Stunden
Meseritz verlassen. Es begann ein entsetzlicher
Leidensweg, den viele, viele nicht überstanden
haben. Unsere paar Sachen haben wir auf
einen Handwagen geladen, ich selbst musste mit
einem Pferd und Kastenwagen alte Leute und
Kranke befördern.
Bis Ende Juni waren noch weitere
1000 Einwohner nach Meseritz zurückgekommen,
so dass wir bei unserer Vertreibung ein
endloser Zug des Elends waren. Hinter dem Stadtgut
Milbradt (er soll auch umgekommen sein) wurden
wir das erste Mal von Polen geplündert. Von
jedem Handwagen oder Karren wurde wahllos das
zuoberst liegende Gepäck heruntergenommen
und in den Graben geworfen, von wo es dann mit
LKW und anderen Fahrzeugen weggefahren wurde.
Ernährungsmäßig war es in Meseritz auszuhalten.
Einer half dem anderen und obwohl wir
pro Person nur 300g Brot bekamen, sonst nichts,
haben wir, weil wir genug Kartoffeln hatten, fast
nie gehungert. Während der Vertreibung sah das
nun ganz anders aus. Wir wurden nicht versorgt,
mussten von den Feldern Früchte stehlen.
Und
bekamen den Hunger sehr zu spüren. Nach entsetzlichen
Mühsalen und Drangsalierungen kamen
wir bei Göritz an die Oder. Dort nahmen uns
die polnischen Vertreibungswachen noch das letzte
ab, auch Pferd und Wagen. Danach gingen wir
bei strömendem Regen ohne ein Dach über dem
Kopf über die Oder weiter.
Wir haben glücklicherweise alles überstanden
und man vergisst ja gottlob vieles Schwere der
Zeit. Unser Leben hing oft an einem seidenen
Faden. So wurde ich im Februar 1945 in Grunow
zum Tode verurteil, weil ich angeblich Gold und
Schmuck vergraben haben sollte. Der Unteroffizier,
der mich erschießen sollte, hatte aber mehr
Freude daran, mich furchtbar zu schlagen und
dann laufen zu lassen. Fast jede Nacht wurde ich
aus dem Keller geholt und woanders eingesperrt.
Meine Kinder und Bauma hatten viel Angst um
mich.“ (DITTMANN 2010).„So kam der 26. Juni 1945, wo wir um 10 Uhr
Abschied von unserer Heimat nahmen. Was auf
der Frankfurter Chaussee los war, kann sich nur
derjenige vorstellen, der mit dabei war. Tränen über
Tränen, das Weinen und Schreien hörte nicht auf.
Die erste Plünderung wurde bei Meyers Berg
durchgeführt und die Hälfte (40 kg pro Person)
wurde uns abgenommen. Es ging über Pieske,
Kurzig, Schermeisel, Zielenzig, Kohlow,
Kunersdorf bis kurz vor Frankfurt/Oder.
Wir durften nicht über die Oder und mussten in
Richtung Reitwein. Dort wurde den Menschen das Letzte, was sie noch besaßen, weggenommen.
Auch unterwegs haben viele ihre wenige Habe
verloren. Außerdem plünderten zurückkehrende
Ausländer aus dem Osten die vertriebenen Menschen
aus. Täglich schafften die ca. 2 000 Vertriebenen
aus Meseritz und der Umgebung 15 bis
20 km zu Fuß. Zu essen gab es nur, was jeder
mitnehmen konnte, meist waren es Pellkartoffeln.
Von Reitwein aus gingen die Meseritzer ihre eigenen
Wege, um eine neue Heimat zu finden.“
(GUTSCHE 2001).„Im Juni 1945 mussten wir dann innerhalb von
10 Minuten unsere Heimat verlassen. Elternlos
und ausgehungert, die Schuhe durchgelaufen ging
es weiter bis zur Oder. Begleitet und getrieben
wurden wir von polnischer Bewachung. Als wir
hinter der Oder waren, zog uns der Treck mit bis
durch das zerstörte Berlin in Richtung Ludwigslust.
Dort wollte man uns aber nicht haben und man
schickte uns wieder zurück nach Lübbenau.
Unterwegs mussten wir ständig um etwas Essbares
betteln. Ich weinte und schämte mich so
sehr und wäre lieber verhungert, aber meine
Schwester bettelte dann für mich mit. In Lübbenau
wurden mir und meiner Schwester eine Unterkunft
bei einem Bauern zugewiesen. Dabei wurden wir
als Zigeuner und Lumpenpack beschimpft. Diese
Demütigungen werde ich, so lange ich lebe, nie
vergessen. Ein großes Dankeschön geht an Familie
Gutsche, die uns liebevoll aufgenommen
hatte.“ (GONDEZKI 2007)„In Angst und Schrecken, nur mit dem Nötigsten
auf dem Handwagen versehen, vom Hof gejagt.
Hinter der Stadt gleich die erste Plünderung.
Die erste Nacht hinter dem Dorf Pieske im
Chausseegraben übernachtet in bitterkalter
Nacht, vom Gewitter und furchtbarem Regen überrascht,
langten wir durchnässt in Grochow an. Dort
konnten wir, wenn auch unter primitiven Verhältnissen,
etwas kochen.
Die nächste Etappe ging dann am Sonnabend
bis Heinersdorf. In Heinersdorf Plünderung im
Schweinestall, furchtbar! Am nächsten Tag über
Drossen nach Zweinert und dort noch mal große
Plünderung von Polen. Dann ging es nach Göritz,
dem letzten Ort vor der Oder. Man sah den Damm,
doch es dauerte stundenlang, der Treck war kilometerlang.
Wir sind glücklich rübergekommen,
immer mit der Angst im Nacken. Dort erwartete
uns noch ein fürchterlicher Weg durch Modder und
eine Gegend, in der man sich verirren konnte, die
sogenannte Oderbruchgegend.
Gott ließ uns aber unsere Kraft und wir fanden
endlich im ganz zerschossenen Dorf eine kurze
Bleibe, ohne Dach und Fenster, das war Reitwein.
Weiter nach Rathstock, Alttucheband, alles Dörfer
in Trümmern, umgeben von gewaltigen
Schlachtfeldern. Wieder zwei Nächte in der
Unheimlichkeit, behindert durch Regen. Die weitere
Wanderschaft ging Richtung Seelow. Auch
dort war alles zerschossen und es blieb uns nur
ein Stall. Von Seelow war die Chaussee nach
Müncheberg gesperrt, nun hieß es wieder Umwege
wandern und nirgends eine Bleibe. Kein
Mensch gab uns Verpflegung oder überhaupt jegliche
Hilfe. Manchmal glaubte man, verzweifeln
zu müssen und die Füße wollten auch nicht mehr
tragen – und wo war unser Ziel?“ (KRUSZYNSKI
2006).In der letzten Frage lag die ganze Tragik der Vertriebenen, weil die meisten nicht wussten, wohin sie gehen sollten. Ziellos irrten sie umher, deutlich an der Abbildung des Treckweges der Familie Kintzel abzulesen.
 |
|
Beginn unseres Treckweges mit Übernachtungen (schwarzes Dreieck)
Eine vergrößtere Abbildung erscheint, wenn sie auf die Karte klicken. |
Treck der Familie Kintzel
An einem heißen Junitag 1945 mussten wir unsere Heimatstadt Meseritz verlassen. Aus meiner Erinnerung und bruchstückhaften Notizen meines Vaters, will ich den Verlauf des Trecks und Erlebnisse rekonstruieren. Mein Vater hatte sich Aufzeichnungen über einzelne Tage angefertigt, die von meiner Mutter ergänzt worden waren.
Leider waren nicht allen Tagen Strecken und Ereignisse zuzuordnen, manchmal wohl auch Vertauschungen, im Nachhinein etwas aufgeschrieben? Ich habe versucht, aus meinen Erinnerungen und unter Zuhilfenahme von verschiedenen Landkarten das zu korrigieren. Die Entfernungen sind den Karten mit verschiedenen Maßstäben entnommen worden. Gut zu lokalisieren waren die Ereignisse von den Tagen, wo Datum und Wochentag angegeben waren.
Der Bericht meiner Eltern beginnt mit dem Tag der Vertreibung:
„26. Juni 1945, vormittags um 10 Uhr aus
Meseritz, erst standen wir an Bretthauers Haus
auf der Straße, dann kamen wir bis Meiers Berg,
dort wurde geplündert. Walters Schulmappe (noch
vom Karl) mit Album von Walters Bildern.“
Meine Eltern, mein Opa und ich zogen aus Meseritz mit einem Handwagen weg, einige Leute hatten auch nur eine Schubkarre, die sie mit ihren wenigen Habseligkeiten beladen hatten. Ganz alte Leute und Gebrechliche wurden bis zur Oder auf einem Pferdefuhrwerk gefahren. Mir ist so, als sei auf einem Wagen Mutter Klein (Gerber Klein) mitgefahren. Umgangssprachlich hatte ich das von meinen Eltern übernommen, die ältere Leute, die ihnen bekannt waren, mit „Mutter“ und Namen anredeten.
Also Mutter Klein kannte ich sehr gut, weil wir als Kinder schon vor 1945, aus Ebels Garten auf dem Topfmarkt kommend, ihre Schöpfbank benutzten, um in die Packlitz zu kommen. Eines Tages im Juni 1945 begegnete ich Mutter Klein im Sonntagsstaat.
Auf meine Frage, wo sie denn hinwolle, sagte sie zu mir:
„Ich will zum Kommandanten,
ich will in Meseritz bleiben.“ Offensichtlich
hatte sie von den Gerüchten gehört, dass wir
Meseritz verlassen müssten. Ihre Bemühungen
und ihr Bittgang waren umsonst, auch sie musste
Meseritz verlassen. Es konnten einige Leute bleiben,
die für Polen – damals hörte ich zum ersten
Mal den Ausdruck – optierten. Mein Spielkamerad
von der Winitze, Helmut Ribowiak, blieb mit
seinen Eltern in Meseritz. Wie lange?Auf Meiers Berg gab es den ersten Halt. Polen plünderten das, was ihnen beliebte. Leider auch meine Schultasche, die schon mein Bruder Karl getragen hatte, mit einem Fotoalbum. Hinterher machte sich meine Mutter Vorwürfe, dass sie die Tasche auf den Handwagen gelegt hatte, um mich beim Tragen zu entlasten. Vielleicht hätte ich sie, getragen auf meinen Schultern, behalten. Man weiß es nicht. Leider wurden uns auch die Betten weggenommen. Manche Leute wurden von den Polen auch geschlagen, dazu verwendeten die Polen eine kurze Peitsche mit Lederriemen, ich hörte dafür den Namen Kantschu.
Ich sah, wie sich ganz wenige Leute über Schützengräben, die im Kornfeld zu sehen waren, davonstahlen. Als ich meinen Vater darauf aufmerksam machte, wurde ich sofort angeherrscht, dass ich meinen Mund zu halten hätte. Solidarität unter den Erwachsenen auch in schwierigen Lebenssituationen!
Über Pieske zogen wir unseren Handwagen bis auf die Höhe von Tempel, links der Chaussee war ein kleines Wäldchen, rechts ging ein Weg nach Tempel.
Am Rande des kleinen Wäldchens baute mein Vater sein Anglerzelt auf, das er sich, ein begeisterter Angler, selbst angefertigt hatte und in dem er im Sommerhalbjahr in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag übernachtete, wenn er an der Obra bei Obergörzig angelte.
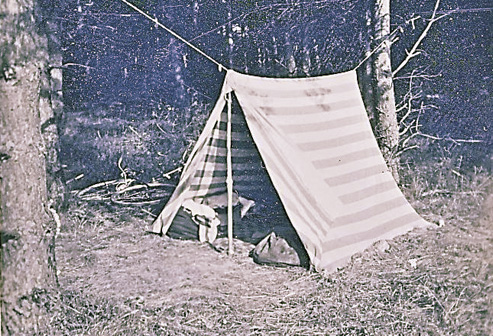 |
| Anglerzelt meines Vaters |
Wir hatten gebratene Kaninchen mit, in einem Sack noch zwei lebende Hühner und Sirup. Da wir auch (noch!) Brot hatten, fiel das Abendessen eigentlich fast üppig aus. Für mich, der schon in früheren Kindheitsjahren gern im Zelt übernachtet hatte, war das wie ein Abenteuer. Ich äußerte mich auch so gegenüber meinem Vater, der schweigend darüber hinwegging, wohl wissend, dass das, was uns erwartete, kein Abenteuer sein würde.
Mein Vater versuchte, in einem nahen See Fische zu fangen, aber es misslang. Der Tag war sehr heiß, abends gab es ein kräftiges Gewitter, wir verschwanden also schnell in unserem Zelt. Einige Leute vom Treck versuchten, in Tempel etwas Essbares aufzutreiben, der Ort war schon geräumt. Sie kamen aber ohne Erfolg zurück.
Am nächsten Tag gelangten wir bis Grochow, es war ein Regentag. In Grochow übernachteten wir in einem Schafstall, auf dem Schafmist lag etwas Stroh, von unten war es warm. In der Nacht kamen plündernde Russen, die auch Frauen suchten. Schreie von Frauen und Kinderweinen zerrissen die Nacht.
Mein Vater hatte sich noch 1944 ein Paar Stiefel anfertigen lassen, Langschäfter, wie er sie nannte, die er immer anzog, wenn er zum Angeln fuhr. Ich meine, es war kurz vor Zielenzig, als ein russischer Soldat die Stiefel wollte. Als mein Vater den Kopf schüttelte, entsicherte der Soldat die Pistole und richtete sie auf meinen Vater. Resigniert und schweren Herzens zog mein Vater seine Stiefel aus, die der Russe nahm und sich wieder in ein Militärauto setzte und davon fuhr. Ich weiß nur noch, dass an der Stelle, wo unser Treck halten musste, weil entgegenkommende Russen anhielten und plünderten, eine steile Straßenböschung vorhanden war. Ich hatte fürchterliche Angst, dass man uns da hinab stürzen würde.
In Zielenzig fielen mir in der Stadt viele farbige Pumpen auf, so etwas kannte ich aus Meseritz nicht. Weiter ging es über Zielenzig bis Langenfeld, wo unser Treck getrennt wurde. Auf wessen Veranlassung das geschah, weiß ich nicht. Die den Treck begleitenden polnischen Soldaten trieben uns immer wieder mit dem Ruf „jechatsch“, „jechatsch“ (fahren, fahren) an. Es war ja alles chaotisch, wir sollten über die Oder, gleichzeitig kamen uns Leute entgegen, die nach Hause wollten. Ich entsinn mich noch, dass uns ein ganz junger deutscher Soldat in abgerissener Uniform pfeifend entgegen kam. „Er freut sich, es geht zu Muttern,“ sagte meine Mutter, nicht wissend, ob nicht seine Mutter das gleiche Schicksal wie wir erleiden musste.
Nach einem Umweg überquerten wir bei Göritz auf einer behelfsmäßigen Brücke die Oder. Auf der Brücke plünderten polnische Soldaten noch einmal die Menschen aus dem Treck. Meine Mutter wurde von einem jungen Burschen mit den Worten „Wo hast Du Tasche“ grob an die Brust gefasst; mein Vater trug zwei Westen, in der unteren hatte er, an einer Uhrkette befestigt, seinen Trauring in einer Westentasche. Bisher hatte das weder ein Russe noch ein Pole entdeckt. Nun aber fasste ein Pole da hin und entwendete ihm seinen Trauring. Mein Vater war sehr bedrückt, hatte er doch – wie die meisten Menschen – gedacht, mit der Oderbrücke beginne ein neues Land mit anderen Bedingungen. Entsprechend fiel seine Reaktion aus, als uns eine Krankenschwester jenseits der Oder mit „Willkommen in Deutschland, nun sind sie frei“ begrüßte.
 |
| Ehemaliger Oderübergang Göritz – Reitwein (2012) |
Die erste Nacht verbrachten wir kurz hinter der Oder in einem Kornfeld, wo wir unser Zelt aufschlugen. Bei strahlendem Sonnenschein gelangten wir am nächsten Tag in das Dorf Reitwein, wo wir in einem halbzerfallenen Haus kampierten. Nach der Oderüberquerung kam es hier zu einer Anhäufung der vertriebenen Menschen aus den verschiedensten Orten. Viele Menschen sah man hier zum letzten Mal. Ich erinnere mich noch an Großvater und Großmutter Körner aus Kurzig, Eltern meiner Tante Frieda Päch von der Winitze. Sie waren schon über 80 Jahre und mit einer Schubkarre unterwegs.
Meine Tante hat trotz intensiver Nachforschung nie etwas von ihnen erfahren, wahrscheinlich sind sie irgendwo zusammengebrochen oder verhungert. Wo sie die Erde bedeckt, weiß kein Mensch.
Fortsetzung folgt!