

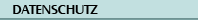 |
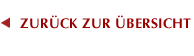
Sächsische Zeitung, Ausgabe Dresden – 05.09.2025
Versöhnungsarbeit mit Schaufel und Pinsel
Die Organisation Pomost birgt in Polen gefallene deutsche Soldaten
aus dem Zweiten Weltkrieg.
Text und Fotos: Irmela Hennig
Mit freundlicher Genehmigung der Autorin, des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. und der Sächsischen Zeitung. Eine Weitergabe des Artikels an Dritte, die kommerzielle Nutzung die Verände.ng des Textes und die verfälschende Bearbeitung von Text und Bildern sind ausdrücklich untersagt.
Henryków Lubański. Es schüttet.
Nicht das ideale Wetter für das, was
Tomasz Czabański und sein Team
an diesem Augusttag vorhaben. In
einem Wald nahe der polnischen
Ortschaft Henryków Lubański
(Rothwasser) wollen sie die sterblichen
Überreste eines mutmaßlichen
Wehrmachtsoldaten ausfindig machen.
Dass sie heute erfolgreich sind,
ist nicht unwahrscheinlich. Denn
Stahlhelm und Schädel des Toten
wurden schon geborgen. Ein
Mann, auf Suche mit einem Metalldetektor,
war darauf gestoßen.
„Solche privaten Aktionen sind
eigentlich verboten. Darauf stehen
hohe Strafen. Sogar Gefängnis“,
weiß Tomasz Czabański. Doch der
Pole hatte sofort die Behörden informiert.
Polizei und Staatsanwaltschaft
waren aktiv geworden.
Schließlich wurde Pomost beauftragt,
die übrigen Gebeine zu finden
und zu bergen.
 |
| Archäologe Marcin Michalski legt im Wald bei Henryków Lubański Gebeine frei. Vermutlich ist es ein Mann, der als Wehrmachtssoldat zum Ende des Zweiten Weltkrieges umgekommen ist. |
Pomost, auf Deutsch „Brücke“, ist eine Organisation mit Sitz in Poznań, die Historiker Czabański und Mitstreiter 1997 gegründet haben. „Wir wollten etwas für die deutschpolnische Freundschaft tun, für Verständigung und Versöhnung“, begründet der inzwischen 67-Jährige.
Seitdem sucht der Vater und mittlerweile zweifache Großvater in der polnischen Erde nach Kriegstoten. Vor allem in Westpolen. Und heute, so der Plan, am Rand von Henryków Lubański, keine 25 Autokilometer östlich von Görlitz.
Schon 25.000 deutsche Tote geborgen
Obwohl der Regen am späten Vormittag heftiger wird, fährt ein Teil des Teams nun los. Prüft, ob die Waldwege passierbar sind. Nach rund 20 Minuten erfährt Czabański per Telefon – es geht. Also kommen er und ein Kollege nach. An diesem Tag begleitet von zwei Mitarbeiterinnen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Seit 2004 ist Pomost direkt im Auftrag der Organisation unterwegs, wenn es um gefallene Soldaten deutscher Herkunft geht. Auch zivile Opfer exhumiert Pomost.
Um die tausend Begräbnisplätze mit insgesamt etwa 25.000 Toten haben die 15 Historiker, Archäologen, Soziologen und weitere Pomost- Mitarbeiter schon ausfindig gemacht. Und das sind nur die Zahlen für deutsche Wehrmachtsangehörige und Zivilpersonen. Die Organisation kümmert sich auch um gefallene polnische Soldaten und die weiterer Nationalitäten.
Auch in Świdnica wird gesucht
Die Arbeit führt die Fachleute kreuz und quer durchs Land. Gestern seien sie in Pommern gewesen. In Kürze gehe es nach Świdnica (Schweidnitz). Dort bergen sie etwa 40 Soldaten, die 1945 mit dem Flugzeug abgestürzt waren.
Hinweise auf mögliche Suchgebiete bekommt Pomost beispielsweise über das Internet, von Einheimischen und aus Akten unter anderem des deutschen Bundesarchivs. Laut der dort verfügbaren „Liste Deutscher Dienststellen“ müssten im angesteuerten Suchgebiet von Henryków Lubański 14 Soldaten liegen.
Etwa 478.000 Wehrmachtsangehörige sind im Zweiten Weltkrieg laut Volksbund auf dem Gebiet des heutigen Polens gefallen. Rund 100.000 von ihnen könnten noch geborgen werden. Einer vielleicht heute.
Nicht weit nach dem Ortsausgang von Henryków geht es auf einen Waldweg. Hier steht das Wasser in Senken knöchelhoch. Das letzte Stück ist mit Autos nicht zu machen; die Gruppe läuft es zu Fuß. Durch nasses Gras, über Heidelbeergestrüpp.
Wenige Hundert Meter nur, dann ist das Ziel erreicht. Weil der Mann, der den Fund gemacht hat, mitgekommen ist, wissen die Männer, wo sie graben müssen. Unter Birken und Eichen arbeiten sie sich voran, erst mit Schaufeln und Spaten. Dann mit Bürstenpinseln und kleinen Kellen. Auch ein Metalldetektor kommt zum Einsatz.
Während rund 1.000 Kilometer weiter östlich ein neuer Krieg tobt, bewältigen hier Engagierte immer noch die Folgen eines Krieges, der 80 Jahre zurückliegt. Das schwingt mit an diesem Tag, an dem der Regen nun doch nachgelassen hat. Und an dem Tomasz Czabański fast flehentlich sagt: „Wir müssen alle im Frieden bleiben.“
Ringsum das mögliche Grab gibt es tiefe Löcher im Boden. Die Fachleute erkennen darin alte Schützengräben. „Hier war früher kein Wald, sondern ein Feld“, erzählt Tomasz Czabański. Ende Januar 1945 rückte die Rote Armee der damaligen Sowjetunion da vor, zerschlug den lokalen Volkssturm – Adolf Hitlers letztes Aufgebot der 16- bis 60-jährigen Männer. Anfang Mai kam es zu weiteren schweren Kämpfen, Vergewaltigungen, Plünderungen, Erschießungen, wie Diane Tempel- Bornett informiert. Sie ist Pressesprecherin beim Volksbund und an diesem Tag vor Ort.
Es dauert nicht lange, dann legen Archäologe Dr. Marcin Michalski und ein Kollege etwas frei, dass ein Laie für eine Wurzel halten könnte. Doch es ist ein Schlüsselbein.
Minute für Minute wird jetzt mehr sichtbar. Die Männer finden Teile einer Lampe und Stoffreste – vermutlich von einer Uniform. Nur die Erkennungsmarke entdecken sie nicht. Die Metallmarke, oft mit Personenkennziffer und anderen Informationen versehen, trugen Soldaten normalerweise an einer Kette um den Hals. Sie kann helfen, die Toten zu identifizieren. „Aber zu Kriegsende wurden sie oft nicht mehr ausgegeben“, so Diane Tempel-Bornett.
20.000 Anfragen pro Jahr
Wie wichtig es ist, den Gefallenen einen Namen zu geben, zeigen die etwa 20.000 Anfragen nach verschollenen und vermissten Personen, die bis heute jährlich beim Volksbund eingehen. Diane Tempel- Bornett hat erlebt, wie hochbetagte Angehörige nach Jahrzehnten zur Ruhe kommen, wenn endlich klar ist, wo beispielsweise der Vater, Großvater, Bruder oder Onkel gestorben ist. Und wenn es ein Grab gibt. Manchmal reiche auch ein Stein mit einem Namen darauf.
Nach rund anderthalb Stunden sind die Gebeine im Wald freigelegt. Ungewöhnlicherweise wurde der Mann auf dem Bauch bestattet. „Warum – das werden wir wohl nicht erfahren“, vermutet Tomasz Czabański.
 |
| In einer sogenannten Wanne zeigt Historiker Tomasz Czapański den aufgefundenen Stahlhelm. |
Weil er einen kompletten Zahnersatz, eine Brücke, hatte und anhand von Schädel und Knochen, schätzen die Pomost-Mitarbeiter das Alter des Mannes auf 55 bis 65 Jahre. Um zu prüfen, ob Gebeine und der eigens mitgebrachte Schädel tatsächlich zusammengehören, setzt Archäologe Michalski letzteren kurz mit den Überresten zusammen. Wie auf ein stummes Zeichen halten dann alle für einen Moment inne. Schließlich werden die Knochen geborgen, in einen Überführungssack gelegt. Der Fundort noch nach Kleinteilen abgesucht, ebenso nach weiteren möglichen Grabstellen. Doch die finden sie heute nicht. Dann wird die Stelle zugeschaufelt.
Später werden die Experten eine sogenannte Gebein-Analyse machen. Auch, um vielleicht doch etwas über die Identität des Mannes zu erfahren. Irgendwann wird er dann bestattet – wohl in Nadolice Wielkie (Groß Nädlitz) bei Wrocław (Breslau) auf einem Sammelfriedhof. (mit kpl)
| Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge |
| Der Volksbund wurde 1919 gegründet.
Der Verein hat 62.000 Mitglieder, rund
530 hauptamtliche Mitarbeiter, ist zuständig
für rund 830 Kriegsgräberstätten
in 45 Ländern. In einer Online-
Gräbersuche sind inzwischen über 5,4
Millionen Namen Kriegstoter und Vermisster
erfasst. Auch für die des Ersten
Weltkrieges sowie des Deutsch-
Französischen Krieges 1870/71 ist der
Volksbund zuständig. Der Verein finanziert
sich zum Teil aus Spenden
und Mitgliedsbeiträgen. Zwischen 30
und 40 Prozent der Mittel für die Arbeit
im Ausland kommen vom Auswärtigen
Amt. Für Jugendarbeit gibt das Bundesfamilienministerium
Geld. Einige
Bundesländer unterstützen bei der Finanzierung
von Bildungsreferentenstellen. www.volksbund.de |