

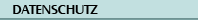 |

Berthold Beitz, Biographie
Der Aufstieg eines Unbescholtenen:
Ostfront I945 – Flucht aus Tirschtiegel
Joachim Käppner
 Der alte Gutshof bei Tirschtiegel ist überfüllt, ein Feldlager der Geschlagenen: Soldaten und Zivilisten, darunter auch Berthold Beitz in einer verdreckten Uniform, entwaffnet und in der Gewalt der Roten Armee.
Der alte Gutshof bei Tirschtiegel ist überfüllt, ein Feldlager der Geschlagenen: Soldaten und Zivilisten, darunter auch Berthold Beitz in einer verdreckten Uniform, entwaffnet und in der Gewalt der Roten Armee.„Wir lagen dort alle durcheinander: Soldaten von der Front und solche, die gerade aus dem Heimaturlaub gekommen waren, und auch Nazis waren dabei, richtige Goldfasane.“
Als „Goldfasane“ werden die NSDAP-Bonzen bezeichnet, wegen ihrer goldenen Knöpfe an der Uniform und ihrer Neigung, sich in sicherer Entfernung von der Front zu halten. Diese hier in Tirschtiegel (heute Trzciel, Polen) haben Pech. Der Hof, in dem die Rotarmisten die gefangenen Deutschen wie menschliches Treibgut zusammengesperrt haben, liegt zwischen verschneiten Feldern und hat eine hohe Steinmauer. In der Ferne wummern die Geschütze, die Front weicht immer mehr zurück, nach Westen Richtung Oder. Die Stimmung ist denkbar bedrückt. Was wird nun aus ihnen werden?
Einer, der sich nicht in sein Schicksal fügen mag, ist Berthold Beitz. Um keinen Preis will er in sowjetische Gefangenschaft geraten, fremden Herren ausgeliefert und bestraft für ein mörderisches System, dem er sich doch verweigert hat. Nun muß er für sich selbst tun, was er drei Jahre lang für andere getan hat: sich nicht fügen, schnell und entschieden handeln.
Er denkt an Flucht. wenn überhaupt, dann ist jetzt Gelegenheit dazu.
Noch sind die deutschen Linien erreichbar, die Oder nicht weit entfernt. Sie wissen nicht, was die Russen mit ihnen vorhaben. Sicher ist nur: für sie erst einmal nach Osten abtransportiert und in einem Gefangenenlager mit Wachtürmen und Stacheldraht eingesperrt werden, sind die Chancen zu entkommen nahe null. Er muß es jetzt wagen oder nie.
Berthold Beitz ist nach seiner Einberufung im April 1944 nach Berlin-Spandau versetzt worden. In der Heimat geben sich noch viele Soldaten Illusionen vom „Endsieg.. hin. Beitz wußte, wie schnell die Rote Armee vorrückte, „daher stand für mich bereits fest, daß der Krieg verloren war. Umso weniger möchte er noch Offizier werden, und mit Hilfe eines Freundes in der Wehrverwaltung verschwanden seine Unterlagen „in die falsche Ablage“ und waren nicht mehr auffindbar.
So war ich denn bei Kriegsende 1945 noch genauso Feldwebel wie zu Kriegsbeginn1939. Er ist erst wenige Tage in Berlin, als er mitten in einen Bombenangriff gerät. Beitz und einige Kameraden sind mit der Straßenbahn bis zum Bahnhof Zoo gefahren, als Luftalarm gegeben wird. Dann sehen sie die Lichter am Himmel. „Das waren die Mosquitos“, sagt Beitz, „schnelle britische Flugzeuge, welche die Leuchtzeichen gesetzt haben.“ Oben, auf dem riesigen Flakbunker am Zoo, dröhnen die 8,8-cm-Kanonen, Scheinwerfer suchen den Himmel ab, der von den Leuchtzeichen gespenstisch erhellt wird, den „Christbäumen“, wie die Leute sagen. Sie markieren das Abwurffeld für die schweren Bomber, deren tiefes Brummen schon zu hören ist.
Beitz und die anderen Soldaten helfen mit, Zivilisten in den Luftschutzbunker zu schaffen. Dann bebt der Boden, die Bomben schlagen irgendwo in der Stadt ein. Sie haben auch die Straßenbahnschienen getroffen, so daß Beitz schließlich den langen \Weg nach Spandau zurücklaufen muß, durch eine vom Krieg gezeichnete, nächtliche Stadt. Noch vor Weihnachten wird das 67. Regiment der Wehrmacht, zu dem er gehört, nach Posen verlegt, in die Nähe der Ostfront. Er bleibt nicht lange dort.
Die militärische Lage des Reiches ist verzweifelt. An der überdehnten Ostfront bereitet die Rote Armee bei Jahresbeginn 1945 einen vernichtenden Schlag vor. Noch steht sie vor den Reichsgrenzen, entlang der Weichsel und in Ostpreußen. Der Generalstabschef des Heeres, General Hans Guderian, hat Hitler nach einer Inspektion seiner Verteidigungslinien gewarnt:
„Die Ostfront ist wie ein Kartenhaus. Wird die Front an einer einzigen Stelle durchstoßen, so fällt sie zusammen.“ Hitler und das Oberkommando der Wehrmacht, dem Diktator hörig bis in die Wirklichkeitsverweigerung hinein, kanzeln Guderian ab. Im Januar 1945 bricht der Sturm los. Im Schneetreiben stoßen zahllose sowjetische Panzer durch die deutschen Stellungen hindurch, von denen nach einem verheerenden Artilleriebombardement nur noch Trümmer geblieben sind. Innerhalb weniger Tage dringen die Russen durch Polen tief nach Westen vor. Eilig werden nun Beitz und seine Einheit nach Osten verlegt.
Obgleich nur im Rang eines Feldwebels und militärisch unerfahren, befehligt Beitz bereits eine Kompanie. Zu viele Offiziere sind schon gefallen. Die Soldaten werden in Viehwaggons verladen und fahren nach Osten - mitten hinein in die Großoffensive der Roten Armee. Es ist eine Illusion, daß sie noch etwas ausrichten können. Doch mitten im Untergang geben sich viele Menschen Illusionen hin: jene, die nicht glauben wollen, daß der Feind tatsächlich nach Deutschland kommen werde; Soldaten, die auf „Wunderwaffen“ hoffen, die nie kommen werden; oder jener Schlachtermeister in Tirschtiegel, der sich bis zuletzt an die Vorschriften und die Obrigkeit klammert. Beitz und seine Männer gehen durch den Ort, sie sind müde und hungrig. Die Front im Osten ist nah.
Beitz betritt das Geschäft und bittet um etwas Fleisch und Speck. „Haben Sie Fleischkarten?“, fragt der Metzger. „Mensch, wir sind Soldaten und kommen aus Berlin. Wir haben alle Hunger. Woher sollen wir Fleischkarten haben?“ „Es tut mir leid, dann kann ich nichts geben.“ Kopfschüttelnd verläßt der Kompaniechef schließlich den Laden.
.
In der Nacht kämpft seine Einheit erstmals
gegen die vorstoßenden Russen und gerät unter
schweren Beschuß. Es ist eiskalt, Beitz’ Soldaten
haben mühsam Schützenlöcher in den kalten Boden
Westpreußens gehackt. Sie stehen auf verlorenem
Posten. Auf beiden Seiten brechen die Tanks
der 2. sowjetischen Panzer-Gardearmee durch.
Das vom Wehrmachtsbericht großsprecherisch
als „Tirschtiegeler Riegel“ gefeierte Grabensystem,
das die örtliche Hitlerjugend schon seit
Sommer 1944 errichtet hat, ist nutzlos gegen die
Wucht des Angriffs. Die Befestigungen sind von
Schneewehen bedeckt, die Linien der Verteidiger
viel zu dünn. Auch Beitz und seine Kompanie ziehen
sich zurück, und nicht mehr alle sind dabei.
Der nächste Morgen. Wieder kommen die
Soldaten an dem Schlachtergeschäft vorbei, nur
diesmal aus der anderen Richtung. Aber jetzt steht
ein Wagen mit angespannten Pferden davor,
daneben eine Frau, die herzzerreißend weint. Die
Schlachterfamilie lädt ihre Habseligkeiten auf und
versucht, im allerletzten Augenblick, die Flucht
nach Westen. Ihre Chancen stehen denkbar
schlecht. Beitz kann es sich nicht verkneifen, den
Mann zu fragen: „Na, und nun?“. Der andere antwortet:
„Ach, gehen Sie ruhig hinein. Sie können
nehmen, was sie wollen.“ Und Beitz sagt: „Also
Jungs, ran.“
Sie werden die Stärkung nötig haben. Einen
Tag später schon rumpeln sowjetische Panzer
durch Tirschtiegel, wo vor dem deutschen Überfall
von 1939 ein Schlagbaum die deutsch-polnische
Grenze markiert hat. Berthold Beitz gerät in
Gefangenschaft und wird mit vielen anderen Deutschen
in den Hof des alten Landgutes getrieben.

Und eben hier sinnt er am zweiten Tag auf
Flucht. Es ist dunkel geworden und sehr kalt. Eine
Handvoll Männer wartet einen günstigen Augenblick
ab. Dann klettern sie über die Hofmauer, springen
auf der anderen Seite hinunter und rennen über
die Felder um ihr Leben. Sie hören Schüsse. Vom Gutshof aus schießen Rotarmisten Leuchtkugeln
in den dunklen Himmel und feuern auf die schemenhaften
Gestalten, die dem Waldrand schon
recht nahe sind. Berthold Beitz schafft es gerade
noch und wirft sich zwischen die schützenden Bäume.
„Neben mir war noch ein Leutnant rausgekommen.
Aber er wurde leider getroffen. Er bekam
einen Kopfschuß ab und war gleich tot.“
Beitz hat keine Mütze, aber glücklicherweise
eine dicke Winterjacke. Er verliert keine Zeit.
„Tagsüber habe ich mich versteckt, nachts bin ich
immer gelaufen, immer nach Westen.“ Er läuft nicht
allein, ein anderer Soldat hat es auch über die Mauer
geschafft. Es ist der Koch eines Berliner Grandhotels,
ein guter Weggefährte, er macht Scherze
und verliert nicht den Mut.
Sie gehen Richtung Oder, an der sich die
Stoßkraft der sowjetischen Offensive vorläufig
bricht. Ihre Flucht führt sie quer durch eine winterliche
Landschaft, die im Chaos des Zusammenbruchs
versinkt. Brennende Dörfer, menschenleere
Höfe, in den Ställen brüllen die Kühe vor Schmerz,
weil niemand mehr da ist, der sie melkt.
Einmal stehen Kinder mit gepackten Sachen auf
der Landstraße. Beitz riskiert es und geht zu ihnen
hin. „Mensch Kinder“, sagt er, „hier könnt ihr
doch nicht bleiben. Lauft doch weg! Lauft nach
Westen.“ Aber die Kleinen hören nicht auf den
Fremden. Wir sollen hier warten, sagen sie, wir
werden bald abgeholt. Irgendjemand hat sie einfach
dort stehen lassen. Erschüttert läuft Beitz
weiter.
Sie schlafen in Heuhaufen, um sich etwas
zu wärmen. Nach sieben Tagen erreichen sie
abends die Oder. Der Fluß ist zugefroren. Das
Westufer halten die Deutschen noch. In einer Kate,
einem Fischerhäuschen, sehen sie ein Licht und
klopfen. Ein älterer Mann öffnet und ruft laut: „Rotfront!“
Er glaubt, vor ihm stünden Russen.
„Hör auf“, flüstert Beitz, „wir sind deutsche
Soldaten.“ „Um Gottes willen! Gleich nebenan sind
die Russen!“ „Das ist uns jetzt scheißegal“, entgegnen
Beitz und sein Kamerad. Die beiden setzen
sich auf das Sofa ihres unfreiwilligen Wirts und
schlafen vor Erschöpfung ein.
Am Morgen gibt der Mann ihnen noch etwas
zu essen und sieht ihnen erleichtert nach, als sie
abziehen. In der nächsten Nacht rutschen sie über
das Eis.
Der Koch hat noch eine herumlaufende Gans
geschnappt und gescherzt: ‚Komm, die haben da
drüben bestimmt nichts zu essen, wir bringen ihnen
eine Gans mit.“ Auf der anderen Seite, bei der
Stadt Guben, liegen deutsche Einheiten. Sie geben
sich zu erkennen und haben es geschafft.
Von der Flucht, einer leichten, aber unbehandelten
Verwundung und starker Unterkühlung geschwächt,
wird Berthold Beitz ins Lazarett gebracht.
Er fährt mit einem Verwundetenzug nach Berlin. Noch steht die Rote Armee an der Oder, erst im April wird sie die Hauptstadt erreichen. Aber der nahe Untergang des Regimes ist dort schon deutlich zu spüren. Die Lazarette sind überfüllt, und eine mitleidige Krankenschwester schreibt auf Beitz’ Krankenzettel: „Heimatlazarett Greifswald“. Berthold Beitz fährt nach Hause.
Er sieht Else und das Kind, ein erleichtertes Wiedersehen, nachdem sie fast die gesamte Kriegszeit gemeinsam durchgestanden haben. Doch Beitz erholt sich bald und muß zurück in den Krieg. Wiederum in Berlin-Spandau, nahe der alten Zitadelle, wartet seine Kompanie im März auf den letzten Ansturm der Roten Armee. Der Zusammenbruch ist nah.
Beitz beobachtet, wie eilig zusammengestellte Einheiten aus Halbwüchsigen in die Züge nach Osten verladen werden. „Das waren Waggons wie jene, mit denen die Juden in die Konzentrationslager gebracht worden waren. Jetzt saßen Jungs darin, vielleicht 15 Jahre alt, denen hing der Stahlhelm auf die Nase, sie konnten nicht einmal hinausgucken. Die mußten jetzt an die Front, und am Bahnsteig standen weinende Eltern, um ihre Kinder zu verabschieden. Das ist doch furchtbar. Das kann man heute gar nicht mehr erklären.“
Der Kampf um Berlin, der bald darauf entbrennt, ist aussichtslos für die Deutschen und kostet über 200 000 Menschen das Leben. Berthold Beitz jedoch ist nicht dabei in den apokalyptischen Szenen der Götterdämmerung des Naziregimes. In seiner Spandauer Kompanie befiehlt ihm ein Vorgesetzter: „Beitz, Sie kommen zu einem Sturmregiment.“ Er packt seine Sachen und soll bei einem Gegenstoß Richtung Potsdam mitmachen. Doch die Russen greifen schon an.
Südwestlich von Berlin sagt Beitz‘ Regimentskommandeur:
„Wir bleiben, wo wir sind.“ Der
Mann stammt aus Bayern und verlädt seine Leute
schließlich in einen der letzten Züge nach Süden.
Auf diese Weise entgeht Beitz’ Einheit der
Umzingelung durch die Russen, die nun den Ring
um die Hauptstadt schließen. Wenige Tage und
sehr viele Tote später wird die rote Fahne über dem
Reichstag wehen.
![]()